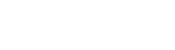Einleitungstext
Die Jagd steht in der Öffentlichkeit oft im Fokus und wird kritisch hinterfragt. Ob im Gespräch mit Freunden, am Stammtisch, bei Begegnungen im Revier oder in Diskussionen mit Menschen, die der Jagd skeptisch gegenüberstehen – Jäger geraten immer wieder in Situationen, in denen sie ihr Handeln erklären und rechtfertigen müssen.
Diese Sammlung von Argumentationshilfen soll Jägerinnen und Jäger dabei unterstützen, fundiert, sachlich und verständlich zu argumentieren. Sie bietet kurze und prägnante Kernpunkte zu zentralen Themen wie Tierschutz, Wildhege, Zusammenarbeit mit Landwirten, Naturschutz und gesellschaftliche Verantwortung.
Ziel ist es, ein positives und realistisches Bild der Jagd zu vermitteln: Jagd ist mehr als der Abschuss von Wild, sie bedeutet Verantwortung, nachhaltiges Handeln und aktiven Naturschutz. Mit den folgenden Argumentationshilfen können Jäger sicher und überzeugend in Gesprächen auftreten und Missverständnisse ausräumen.
Der Begriff der Hege ist ein historisch gewachsener und zentraler Grundpfeiler des Jagdrechts. Er wurde bereits früh, etwa von forstlichen Klassikern wie Georg Ludwig Hartig, weit gefasst und umfasste von Anfang an alle Tierarten, die dem Jagdrecht unterliegen. Hege gilt unabhängig davon, ob eine Art bejagt werden darf oder einer Jagdzeit unterliegt. Grundeigentümer beziehungsweise Jagdausübungsberechtigte sind verpflichtet, sämtliche jagdrechtlich erfassten Arten zu schützen und in ihrem Bestand sowie in ihren Lebensräumen zu sichern. Lediglich für bestimmte invasive Neozooen besteht aufgrund europarechtlicher Vorgaben ein Hegeverbot, wobei die Einstufung einzelner Arten als invasiv kritisch zu hinterfragen ist.
Die Bejagung von Alttieren auf Drückjagden ist ein komplexes und sensibles Thema. Es gibt eine Reihe von Gründen, die deutlich gegen den Abschuss von Alttieren unter diesen Bedingungen sprechen.
1. Muttertierschutz
Auf Drückstöberjagden ist nicht sicherzustellen, dass ein Alttier tatsächlich ohne Kalb ist. Hunde trennen häufig Kälber und Alttiere. Ein Abschuss birgt daher stets das Risiko, ein führendes Tier zu erlegen – ein klarer Verstoß gegen den Muttertierschutz und tierschutzrechtliche Grundsätze.
Die Frühjahrsbejagung ist jagdpolitisch nicht zu rechtfertigen. Sie steht im Widerspruch zu den Grundsätzen eines verantwortungsvollen, tierschutzgerechten und ökologisch wirksamen Wildtiermanagements. Aus wildbiologischer Sicht befindet sich das Schalenwild im Frühjahr in einer Regenerationsphase nach dem Winter. In dieser Zeit sind die Energiereserven erschöpft, und das Wild ist darauf angewiesen, auf den ersten Grünflächen ungestört Nahrung aufzunehmen. Bejagung in dieser Phase führt zu einer massiven Beunruhigung: Das Wild meidet offene Flächen, verlagert seine Äsung in den Wald und verursacht dort zusätzliche Verbissschäden. Damit wirkt die Frühjahrsbejagung den forstlichen Zielsetzungen unmittelbar entgegen.
1. Wildbiologische Gründe
- Natürliche Ernährung fördern: Eine begrenzte Kirrung zwingt das Wild, sein Futter überwiegend aus der Natur aufzunehmen. So bleiben Äsungs- und Wanderverhalten naturnah.
- Überhöhte Wildkonzentration vermeiden: Große oder übermäßige Kirrungen ziehen unnatürlich viele Stücke an, fördern Stress und können zu Wildschäden führen.
- Gesundheitsschutz: Zu viele Tiere an einem Platz erhöhen das Risiko für Krankheitsübertragungen (z. B. Schweinepest, Parasiten).
1. Pflege des jagdlichen Brauchtums
- Die Waidmannssprache ist ein Teil des immateriellen Kulturerbes und verbindet heutige Jäger mit Jahrhunderten jagdlicher Tradition.
- Wer sie verwendet, zeigt Wertschätzung für die Geschichte, Kultur und Werte der Jagd.
- Sie ist Ausdruck des Respekts gegenüber dem Wild und dem Handwerk der Jagd.
1. Zweck der Methode
- Praxisgerechte Ausbildung: Jagdhunde müssen lernen, mit lebendem Wild sachgerecht umzugehen – etwa das Anzeigen, Verfolgen, Stellen oder Apportieren. Dies ist mit Attrappen oder totem Wild nur eingeschränkt möglich.
- Tierschutzgerechter Jagdbetrieb: Gut ausgebildete Hunde verkürzen im späteren Jagdbetrieb die Leidenszeit von angeschossenem Wild, weil sie es schnell finden, sichern und dem Jäger zutragen.
1. Naturschutz & Wildtiermanagement
- In vielen Ländern (z. B. in Afrika, Osteuropa oder Zentralasien) ist die Jagd ein wichtiges Instrument, um Wildbestände nachhaltig zu regulieren.
- Ohne Jagd würden sich bestimmte Arten (z. B. Antilopen, Wildziegen, Wildschweine) unkontrolliert vermehren, was zu Überweidung, Schäden an Lebensräumen und Konflikten mit der Landwirtschaft führt.
- Bei Raubwild (z. B. Löwe, Leopard) trägt kontrollierte Bejagung dazu bei, Bestände in einem Gleichgewicht zu halten, da natürliche Regulierungsmechanismen eingeschränkt sind.
1. Wildbiologische Gründe
- Angepasste Altersstruktur: Eine frühe Kälberbejagung unterstützt eine ausgewogene Altersstruktur im Rotwildbestand.
- Wildruhe: Früh erlegte Kälber reduzieren den Jagddruck im Herbst, wenn das übrige Rotwild weniger gestört werden sollte.
- Hohe Wiedererkennungsrate: Im August ist das Kalb noch klar bei der führenden Hirschkuh, was eine sichere Ansprache ermöglicht. Später im Jahr wird die Unterscheidung schwieriger.
2. Tierschutzaspekte
- Schonung der Alttiere: Durch die Entnahme von Kälbern im Sommer werden führende Hirschkühe im Winter entlastet, da sie weniger Energie für die Aufzucht benötigen.
1. Tierschutz und Waidgerechtigkeit
- Unfaire Jagdmethoden: Nachtoptiken (Wärmebild- und Nachtsichtgeräte) verschaffen Jägerinnen und Jägern einen erheblichen Vorteil, der dem Grundsatz der Waidgerechtigkeit widerspricht.
- Gefährdung von Muttertieren: Bei Nacht ist die sichere Unterscheidung zwischen führenden und nicht-führenden Tieren (z. B. Bachen mit Frischlingen) erschwert. Nachtoptiken können dies nicht zuverlässig gewährleisten.
- Stress und Leid: Wildtiere haben in der Dunkelheit einen natürlichen Schutzraum. Durch technische Hilfsmittel wird dieser genommen, was unnötigen Stress und Leiden verursacht.
1. Ausgangslage
- In Deutschland leben schätzungsweise 15,7 Millionen Katzen davon 2–3 Millionen streunende Katzen ohne festen Besitzer.
- Viele sind verwilderte Nachkommen von Hauskatzen.
- Sie vermehren sich schnell: Eine Katze kann im Jahr mehrere Würfe mit 3–6 Jungtieren haben.
- Problemfelder: Artenschutz, Tiergesundheit, öffentliche Ordnung.
2. Argumente für die Bejagung
a) Artenschutz
- Streunende Katzen sind erhebliche Jäger: Vögel, Reptilien, Kleinsäuger.
- Schätzungen gehen von 100–200 Millionen getöteten Vögeln jährlich in Deutschland durch Katzen aus.
- Besonders gefährdet: Bodenbrüter (z. B. Feldlerche, Rebhuhn), Amphibien, geschützte Kleinsäuger.
- Bejagung kann helfen, lokale Bestände bedrohter Arten zu stabilisieren.
1. Waidgerechte Jagdform
- Die Baujagd (auch Bodenjagd oder Bauarbeit genannt) ist eine traditionelle, waidgerechte und tierschutzgerechte Methode.
- Sie wird vor allem in den Wintermonaten durchgeführt, also zu einer Zeit, in der keine Jungtiere im Bau sind. Dadurch wird vermieden, dass Welpen verwaisen.
2. Notwendigkeit der Bestandsregulierung
- In unserer Kulturlandschaft sind Fuchsbestände gebietsweise stark überhöht.
- Ohne Regulierung würden Füchse zu einer deutlichen Gefährdung für Niederwildarten wie Hase, Rebhuhn oder Fasan.
- Der Fuchs als ausgesprochener Kulturfolger profitiert von menschlicher Zivilisation und hat in vielen Regionen kaum natürliche Feinde – daher ist eine Bejagung notwendig.
- In den 1930er-Jahren lag die Fuchsstrecke in Deutschland bei rund 200.000 Tieren. Bis Mitte der 1990er-Jahre stieg sie auf etwa 600.000 an und bewegt sich heute auf einem Niveau von ungefähr 500.000 erlegten Füchsen pro Jahr.
Einleitung
Seit der Rückkehr des Wolfes nach Deutschland vor rund zwei Jahrzehnten wächst seine Population kontinuierlich – begleitet von intensiven Diskussionen über seine Rolle im Ökosystem und seinen Einfluss auf Wildbestände. Der folgende Beitrag beleuchtet den aktuellen Wolfsbestand, die Entwicklung seiner Zahl sowie den geschätzten Fleischbedarf der Tiere. Anhand wissenschaftlicher Daten wird aufgezeigt, wie viele Wildtiere der Wolf jährlich erbeutet und wie dies im Verhältnis zur Jagdstrecke von Reh-, Schwarz- und Rotwild steht. Dabei wird auch berücksichtigt, dass die Wolfsdichte regional stark schwankt und damit auch die ökologischen Auswirkungen lokal sehr unterschiedlich ausfallen können.
Position: Die Kitzrettung vor der Mahd ist notwendig und sinnvoll.
1. Verantwortung für Wildtiere
- Jäger haben nach dem Bundesjagdgesetz die Pflicht, das Wild zu hegen und unnötiges Leiden zu vermeiden.
- Kitzrettung ist gelebter Tierschutz: Rehkitze sind in den ersten Lebenswochen nicht fluchtfähig und können sich nicht selbst retten.