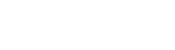1. Wildbiologische Gründe
- Natürliche Ernährung fördern: Eine begrenzte Kirrung zwingt das Wild, sein Futter überwiegend aus der Natur aufzunehmen. So bleiben Äsungs- und Wanderverhalten naturnah.
- Überhöhte Wildkonzentration vermeiden: Große oder übermäßige Kirrungen ziehen unnatürlich viele Stücke an, fördern Stress und können zu Wildschäden führen.
- Gesundheitsschutz: Zu viele Tiere an einem Platz erhöhen das Risiko für Krankheitsübertragungen (z. B. Schweinepest, Parasiten).
2. Jagdethische Gründe
- Fairer Ansatz: Eine maßvolle Kirrung unterstützt die Ansprache und selektive Bejagung, ohne dass die Jagd zur „Fütterung mit Schuss“ verkommt.
- Respekt vor dem Wild: Kleine, begrenzte Kirrungen halten den Charakter als jagdliches Hilfsmittel und vermeiden, dass Wild übermäßig an Menschenhand gewöhnt wird.
3. Jagdpraktische Gründe
- Gezielte Steuerung: Eine begrenzte Kirrung lenkt Wild verlässlich an bestimmte Stellen, erleichtert die Bejagung und ermöglicht eine tierschutzgerechte, präzise Schussabgabe.
- Übersichtlichkeit: Weniger Futter bedeutet weniger Konkurrenz und Unruhe am Platz, wodurch die Ansprache des einzelnen Stückes besser gelingt.
- Vermeidung von Abhängigkeiten: Wenn Kirrungen übertrieben betrieben werden, kann das Wild standorttreu am Futterplatz verharren, statt das Revier gleichmäßig zu nutzen.
4. Gesellschaftliche und rechtliche Gründe
- Nachvollziehbarkeit nach außen: Begrenzte Kirrung zeigt der Öffentlichkeit, dass Jäger verantwortungsvoll und maßvoll mit Hilfsmitteln umgehen.
- Rechtskonformität: In vielen Bundesländern ist die Menge der ausgebrachten Kirrung gesetzlich geregelt. Wer sich daran hält, wahrt das Ansehen der Jägerschaft.
- Akzeptanz sichern: Maßvolle Kirrung wirkt Wildschäden entgegen und zeigt Landwirten sowie Grundeigentümern, dass Jäger ihre Verantwortung ernst nehmen.
Kernbotschaft:
Die Begrenzung der Kirrung dient nicht nur der Wildbiologie und Jagdpraxis, sondern stärkt auch die jagdethische Glaubwürdigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz der Jagd.