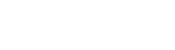Von Volker Seifert
Das Volkslied „Ein Männlein steht im Walde“ gehört zu den bekanntesten Kinderlieder im deutschen Sprachraum. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein schlichtes Rätsellied, doch seine kulturelle Bedeutung reicht weit darüber hinaus. Entstanden ist es 1843 aus der Feder von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der mit wenigen, eindrücklichen Versen ein Naturbild zeichnete: „Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm, es hat vor lauter Purpur ein Mäntlein um“*¹. Schon diese poetische Beschreibung hebt die Hagebutte aus der alltäglichen Wahrnehmung heraus und verleiht ihr eine geheimnisvolle Gestalt.
Gerade diese Verwandlung einer Pflanze in ein „Männlein“ macht den Reiz des Liedes aus. Natur wird hier nicht nüchtern beschrieben, sondern anthropomorphisiert und märchenhaft aufgeladen. Damit führt das Lied Kinder spielerisch an die genaue Beobachtung ihrer Umwelt heran und verbindet Naturwahrnehmung mit kultureller Deutung².
Die Symbolik der Hagebutte lässt sich vielschichtig lesen. Ihre rote Farbe – das „purpurne Mäntlein“ – und der „schwarze Käpplein“-Rest der Blüte³ machen sie im Wald unverwechselbar. Darüber hinaus gilt die Frucht seit Jahrhunderten als Heilmittel, reich an Vitamin C und in der Volksmedizin für Tees und Öle genutzt⁴. Sie wird damit zu einem Sinnbild für Lebenskraft und stille Beständigkeit, die auch im kargen Herbst Bestand hat.
In der Kulturgeschichte hat das Lied zudem religiös-symbolische Deutungen erfahren. Manche Interpreten sehen in der Gestalt des „Männleins“ eine Anspielung auf Christus: das Purpur als Farbe des Leidens, das stille Stehen als Bild der Demut, die unscheinbare Erscheinung als Zeichen des Verborgenen⁵. Ob man dieser Lesart folgt oder nicht – deutlich wird, dass das Lied nicht nur ein kindliches Naturspiel darstellt, sondern Raum für tiefere kulturelle und spirituelle Bedeutungen eröffnet.
So vereint „Ein Männlein steht im Walde“ Naturbeobachtung, Volkskunde und Symbolik. Es zeigt, wie selbst die kleinste Pflanze im Lied und in der Vorstellungskraft der Menschen zu einer Gestalt von poetischer und kultureller Strahlkraft werden kann.
Etymologie
Der Name Hagebutte hat eine lange sprachgeschichtliche Tradition und lässt sich bis ins Althochdeutsche zurückverfolgen. Der erste Bestandteil, „Hage-“, stammt von althochdeutsch hag bzw. mittelhochdeutsch hac, das eine „Hecke“ oder ein „Dorngestrüpp“ bezeichnete (DWDS, s. v. Hagebutte). Damit verweist der Wortteil auf den typischen Standort der Pflanze: die Hecken- und Waldränder, an denen die Wildrose häufig wächst. Der zweite Bestandteil, „-butte“, geht auf mittelhochdeutsch butze oder butt(e) zurück und bedeutete „Frucht“ oder „Beere“ (Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. 10, Sp. 2585 ff.). Zusammengenommen ergibt sich somit die wörtliche Bedeutung „Frucht der Heckenrose“.
Im Etymologischen Wörterbuch des Deutschen von Kluge wird diese Zusammensetzung ebenfalls bestätigt: Hagebutte sei „aus hag = Hecke und butte = Frucht gebildet“ und bezeichnete ursprünglich die Frucht der Hundsrose (Rosa canina) (Kluge 2011, S. 4209). Die Brüder Grimm vermerken außerdem, dass der Name in alten Texten auch in der Form hagenbutte oder hagenbutz erscheint und teilweise sogar auf den Strauch selbst übertragen wurde (Grimm, DWB, Bd. 10, Sp. 2586).
Damit zeigt sich, dass der heute so geläufige Name Hagebutte eine direkte Verbindung von Naturraum und Frucht herstellt: ein Gewächs der Heckenlandschaft, dessen auffällige Frucht schon früh in Sprache, Volkskunde und Heiltradition eine besondere Rolle spielte.
Fußnoten
¹ Hoffmann von Fallersleben, Ein Männlein steht im Walde, 1843.
² Vgl. Rölleke, Heinz: Das Volkslied im kulturellen Gedächtnis. Stuttgart 1995, S. 87f.
³ Botanische Erklärung: Der schwarze „Käppchen“-Rest ist der verwelkte Kelch der Rose.
⁴ Vgl. Bühring, Ulrike: Heilpflanzenpraxis heute. Stuttgart 2016, S. 132.
⁵ Vgl. Zieglschmid, Albert: Religiöse Symbolik im deutschen Volkslied. München 1938, S. 45.