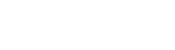Von Volker Seifert
Einleitung
Die Philosophie Martin Heideggers (* 26. September 1889 in Meßkirch; † 26. Mai 1976 in Freiburg im Breisgau) hat die moderne Debatte um das Sein, das Leben und den Tod maßgeblich geprägt. Während seine Analysen in Sein und Zeit (1927) die Endlichkeit des menschlichen Daseins in den Mittelpunkt stellen, bleibt die Frage nach dem Tod des Tieres nur indirekt angesprochen. Gerade im Kontext der Jagd, in der das Tier vom Menschen getötet wird, ergibt sich eine besondere Spannung: Welche ontologische Stellung nimmt der Tod des Tieres ein, wenn Heidegger den Tod doch primär als existenzial versteht? Und was bedeutet es, wenn der Jäger über das Leben und Sterben des Tieres entscheidet?
Heideggers Todesverständnis
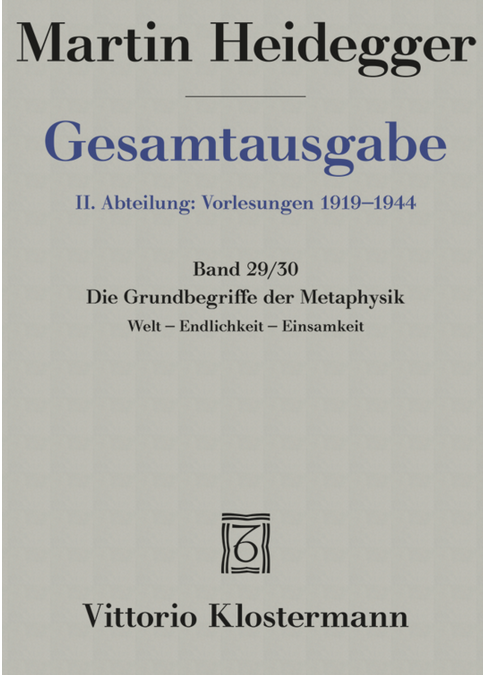 Heidegger fasst den Tod nicht als biologisches Ende, sondern als die äußerste Möglichkeit des Daseins. „Sein zum Tode“ ist die Weise, in der das Dasein sich zu seiner Endlichkeit verhält. Der Tod ist dabei nicht ein Ereignis, sondern eine Struktur des Daseins: Er eröffnet die Möglichkeit zu einer existenziellen Authentizität. Tod ist hier nicht bloß „Verenden“ (Ableben), sondern die Möglichkeit des Nicht-mehr-Seins, die jedem Menschen eigentümlich zukommt.
Heidegger fasst den Tod nicht als biologisches Ende, sondern als die äußerste Möglichkeit des Daseins. „Sein zum Tode“ ist die Weise, in der das Dasein sich zu seiner Endlichkeit verhält. Der Tod ist dabei nicht ein Ereignis, sondern eine Struktur des Daseins: Er eröffnet die Möglichkeit zu einer existenziellen Authentizität. Tod ist hier nicht bloß „Verenden“ (Ableben), sondern die Möglichkeit des Nicht-mehr-Seins, die jedem Menschen eigentümlich zukommt.
„Der Tod ist die Möglichkeit der schlechthinnigen Unmöglichkeit des Daseins.“
(Sein und Zeit, §50, S. 262, GA 2)
„Der Tod ist in seinem Wesen die je eigene, unbezügliche, unüberholbare Möglichkeit.“
(Sein und Zeit, §50, S. 263, GA 2)
Tierisches Leben und „Weltarmut“
In seiner späteren Auseinandersetzung mit dem Tier (vor allem in den Freiburger Vorlesungen 1929/30, Die Grundbegriffe der Metaphysik), bestimmt Heidegger das Tier als „weltarm“. Das Tier ist zwar lebendig, doch es verfügt nicht über Welt in jenem Sinne, in dem der Mensch weltbildend ist. Das Tier ist gefangen im Umkreis des Umweltlichen, ohne Möglichkeit zur Selbsttranszendenz. In dieser Perspektive fällt der Tod des Tieres nicht in dieselbe Dimension wie der Tod des Menschen. Das Tier „verendet“ – es stirbt nicht als ein Seiendes, das den Tod in der Weise seines Seins antizipiert.
„Das Tier hat im Unterschied zum Menschen keine Welt, sondern ist in seiner Benommenheit an einen Umkreis gebannt.“
(Die Grundbegriffe der Metaphysik, GA 29/30, S. 358)
„Das Tier stirbt nicht, sondern es verendet.“
(Die Grundbegriffe der Metaphysik, GA 29/30, S. 292)
Heidegger entfaltet in den Grundbegriffen der Metaphysik (1929/30) die berühmte Dreiteilung:
- Das Weltlose (z. B. Gestein) ist völlig ohne Bezug.
- Das Weltarme (Tier) ist nicht weltlos, sondern eingeschränkt: es ist entzogen von der Welt, gleichsam gebannt in einen Umkreis, den es nicht transzendieren kann.
- Der Mensch hingegen ist weltbildend: Er eröffnet einen Raum der Bedeutung, Geschichte, Sprache.
Das Tier ist weltarm, weil es zwar lebendig ist und auf ein Umfeld reagiert, jedoch nicht in der Lage ist, Welt im Sinne einer Offenheit des Seins zu erfahren. Sein Verhalten ist durch Reiz-Umkreis, Instinkt und Bindung bestimmt. Das Tier ist „benommen“ (Benommenheit), es „hat“ Umwelt, aber nicht Welt.
Das Töten in der Jagd
Heideggers Bestimmung des Tieres als „weltarm“ gewinnt im Vollzug der Jagd eine besondere Konkretion. Das Tier, so Heidegger, ist in seiner „Benommenheit“ an einen Umkreis von Reizen und Instinkten gebunden, ohne die Möglichkeit, Welt im Sinne einer Offenheit des Seins zu erschließen. In der Jagdsituation zeigt sich dies auf prägnante Weise: Das Wild reagiert auf Geräusche, Gerüche, Bewegungen, doch es versteht diese nicht als „Zeichen“ in einem existenzialen Horizont. Es flieht, verharrt, folgt Trieben – aber es weiß nicht um seine Bedrohung als solche. Sein Tod bleibt ein Verenden, nicht ein „Sein zum Tode“.
„Das Tier ist benommen. Es ist eingefangen in einen Umkreis von Reizen, ohne den Freiraum der Welt zu eröffnen.“
(Die Grundbegriffe der Metaphysik, GA 29/30, S. 370)
Der Jäger hingegen steht dem Tier als weltbildendes Dasein gegenüber. Sein Tun ist nicht bloß Reiz-Reaktion, sondern eingebettet in Bedeutungszusammenhänge: Jagdtradition, Sprache, Ethik, Symbolik und nicht zuletzt das eigene Verhältnis zur Endlichkeit. Der Akt des Tötens ist damit mehr als eine biologische Handlung – er ist ein kulturell gerahmtes Ereignis, in dem sich die Differenz von Weltarmut und Weltbildung scharf abzeichnet.
Gerade in der Jagd wird deutlich, wie das „weltarme“ Tier durch den Menschen in seine Welt hineingezogen wird: Sein Tod erhält Sinn als Beute, Nahrung, Trophäe oder Ritual. Der Jäger verwandelt das bloße Verenden in ein Ereignis mit Bedeutung. Damit wird die Asymmetrie ontologisch greifbar: Das Tier bleibt im Bann seiner Umwelt, der Mensch dagegen formt aus dem Töten ein weltkonstituierendes Handeln.
Ontologische Asymmetrie
Hier zeigt sich eine fundamentale Asymmetrie: Der Jäger kann sein Handeln im Horizont des Todes reflektieren, der ihm selbst als Möglichkeit zukommt; das Tier jedoch bleibt ohne diese Dimension. Dennoch wird das Tier in der Jagd in die Welt des Menschen hineingezogen: Sein Tod erscheint nicht mehr nur als ein biologisches Verenden, sondern als ein Geschehen, das Teil einer menschlichen Bedeutungsstruktur ist – sei es in Form von Nahrung, Trophäe oder Ritual.
„Das Dasein ist in der Weise, daß es je sein eigenstes Sein als Möglichkeit zu sein hat.“
(Sein und Zeit, §45, S. 232, GA 2)
Der Tod des Tieres erhält somit einen doppelten Status: ontologisch betrachtet bleibt er das bloße Ende des Lebendigen, existenzial betrachtet wird er durch das Handeln des Jägers in einen Bedeutungszusammenhang gestellt, der über das Tier selbst hinausweist.
Schlussfolgerung
Der heideggersche Todesbegriff macht deutlich, dass sich die Todeserfahrung des Menschen nicht auf das Tier übertragen lässt. Das Tier kennt kein „Sein zum Tode“. Doch gerade in der Jagd zeigt sich, dass der Mensch das Tier nicht einfach verenden lässt, sondern seinen Tod als Teil seiner eigenen Welt vollzieht und deutet. Das Töten wird so zu einem Spiegel menschlicher Existenzialität: Indem der Jäger den Tod des Tieres hervorruft, begegnet er mittelbar seinem eigenen Sein zum Tode.
„Das Sein zum Tode ist das vorgreifende Entschließen zum eigensten Sein.“
(Sein und Zeit, §53, S. 307, GA 2)