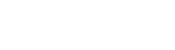Bild: Rainer Schmidt-Arkebek / Text: Volker Seifert

Das Gemälde, das ich betrachte,
scheint aus einer fernen Zeit herübergetragen,
in der die Farben noch aus Erde und Harz
gemischt wurden.
Ein Mann in Lodenmantel sitzt auf einem Baumstumpf,
nicht ganz wie lebendig,
eher wie in einer starren, unverrückbaren Pose.
Die Bockbüchsflinte, seitlich an ihn gelehnt,
ist nicht länger Werkzeug,
sondern ein Zeichen,
das zugleich Distanz und Nähe zur Tat verrät.
Vor ihm, diagonal zur Komposition gelegt,
der Hirsch.
Noch Körper, noch Fell,
doch der Schädel, unerbittlich weiß,
bereits vom Fleisch entbunden,
als habe ein unsichtbarer Prozess
sein Werk vollendet,
bevor die Farben trocknen konnten.
Dieses Weiß, dieses Leuchten des Knochens
durchschneidet das satte Grün
und die dunklen Brauntöne,
die ansonsten eine beinahe tröstliche Ruhe tragen.
Es ist, als sei die Leinwand
ein Erinnerungsraum,
in dem das Vergehen
sich deutlicher einschreibt
als das Bestehen.
Man fragt sich,
was den Maler bewogen haben mag,
diese eigentümliche Szene festzuhalten:
War es der Stolz auf die Jagd,
die alte Tradition des Waldes,
die er in würdigen Farben bewahren wollte?
Oder spürte er,
während er den Pinsel führte,
dass in dieser Gegenüberstellung von Mensch und Tier,
von Fell und Knochen,
eine Wahrheit lag,
die über den Augenblick hinausreicht?
Vielleicht wollte er zeigen,
wie untrennbar verbunden sind
die Gestalt des Jägers und die des Gejagten,
wie beide, eingefasst im selben Farbspektrum,
Teil einer Ordnung bleiben,
die nicht vom Willen des Menschen abhängt.
Vielleicht aber ist es auch
das stille Eingeständnis
einer Schuld, die nicht benannt wird,
ein Bewusstsein dafür,
dass jeder Triumph über die Natur
zugleich ein Memento mori hervorbringt,
sichtbar im Knochen,
der im Bild zum eigentlichen Mittelpunkt wird.
So hängt das Werk an der Wand,
schwer von Farbe,
und dennoch leicht verschiebbar
in die Fragen, die es hinterlässt:
Hat der Maler das Leben gefeiert
oder den Tod bezeugt?
Hat er einen Augenblick festgehalten
oder eine ganze Geschichte verschlüsselt?
Und ist es nicht denkbar,
dass er, indem er den Jäger malte,
vor allem von sich selbst sprach –
von seiner eigenen Faszination
für das, was vergeht,
und von dem Versuch,
es für einen Moment
auf Leinwand zu bannen?