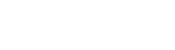Von Volker Seifert
Johann Sebastian Bachs Arie „Schafe können sicher weiden“, ursprünglich konzipiert als Alt-Arie mit zwei obligaten Blockflöten und Basso continuo im Rahmen der Jagdkantate BWV 208, zählt heute zu seinen meistgespielten Werken. Ihre Popularität verdankt sich nicht zuletzt der Umsetzung in zahlreichen Bearbeitungen, unter denen die Klavierauszüge des 19. und 20. Jahrhunderts eine besondere Stellung einnehmen. Diese Bearbeitungen transformieren nicht nur das musikalische Material, sondern eröffnen auch neue ästhetische Deutungsräume. Eine musikwissenschaftliche Betrachtung des Klavierauszugs verlangt daher die Analyse der kompositorischen Essenz, die unter der klanglichen Reduktion weiterwirkt.
I. Ausgangslage: Die originale Instrumentation
Im Original erklingt die Arie in B-Dur und ist besetzt mit einer Altstimme, zwei Blockflöten und Basso continuo. Die Flöten umspielen einander in paralleler Führung, oft im Terz- oder Sextabstand, wodurch eine pastorale Klangfarbe erzeugt wird. Die Sängerin agiert weitgehend innerhalb des Mittellagenbereichs mit ruhiger, syllabischer Textverteilung.
Ein wesentliches Merkmal ist das feingliedrige Wechselspiel zwischen den Flötenlinien und der Gesangsstimme. Der continuo setzt lediglich eine stabilisierende, zurückgenommene Funktion, was die Transparenz des Satzes erhöht und den Idyllcharakter unterstreicht (1).
II. Vom Vokaltrio zur Klavierfassung: Die Transkriptionsherausforderung
Ein Klavierauszug dieser Arie steht vor der Herausforderung, drei kontrastierende Elemente – Melodie, instrumentale Imitation und harmonisches Fundament – auf einem homogenen Tasteninstrument abzubilden. Frühromantische Bearbeitungen (z. B. von Friedrich Wilhelm Birnstiel oder später von Egon Petri) verfolgen unterschiedliche Strategien:
-
Die obligaten Flötenstimmen werden zumeist in die rechte Hand übernommen, oft in doppelt geführter Terzenstruktur, wobei die fließenden Sechzehntelbewegungen der Flötenfigur beibehalten oder durch arpeggierte Akkorde ersetzt werden.
-
Die Gesangsstimme wird entweder ebenfalls in die rechte Hand integriert oder in einer vereinfachten, leicht abgesetzten Melodielinie geführt, sodass eine polyphone Entsprechung gewahrt bleibt.
-
Die Basslinie folgt meist der Generalbassstimme, wobei eine Ausfüllung durch typische Generalbassformeln erfolgt (z. B. Synkopierungen, gebrochene Sextakkorde).
Die bekannteste, oft gedruckte Klavierversion reduziert somit nicht nur das dreischichtige Vokal-Instrumentalgefüge, sondern interpretiert es klanglich und stilistisch neu – oft mit Blick auf das bürgerliche Musizieren im Salon des 19. Jahrhunderts (2).
III. Musikalische Wirkung der Reduktion
Die klangliche Homogenisierung durch das Klavier verändert die ästhetische Wirkung der Arie erheblich. Während im Original eine deutliche Rollenverteilung zwischen singender Stimme, instrumentaler Figuration und klanglicher Tiefe besteht, erzeugt die Klavierfassung eine horizontal verdichtete, vertikal gebundene Textur. Die pastorale Transparenz wird durch eine eher liedhafte oder gar choralartige Klarheit ersetzt.
Zudem wandelt sich der Affekt: Wo im Original Leichtigkeit und Naturverbundenheit dominieren, wirkt die Klavierfassung oft verinnerlicht, fast kontemplativ. Das liegt insbesondere daran, dass die Phrasierung, die Atemräume und die Artikulationsvielfalt des Originals nur bedingt übertragen werden können.
IV. Wirkungsgeschichte und Rezeption
„Schafe können sicher weiden“ avancierte im 19. Jahrhundert zu einem beliebten Stück für häusliches Musizieren, Trauerfeiern, Hochzeiten und bürgerliche Hauskonzerte. Diese Popularität ist wesentlich durch die Klavierfassung mitbedingt. Die Reduktion wirkte wie ein Filter, durch den die Arie zu einem ikonischen Musikstück des „edlen Bachs“ stilisiert wurde – fern jeder höfischen Kontextualisierung und pastoralen Thematik.
Diese Verschiebung geht einher mit der romantischen Bachrezeption, die ihn vor allem als Propheten des innerlichen Ausdrucks verehrte. Die Klavierauszüge wurden dabei nicht als Ersatz für die Aufführungspraxis, sondern als eigenständige Interpretationen verstanden – als „sprechende Partituren“ einer verlorenen Klangwelt (3).
V. Fazit
Die Klavierfassung von „Schafe können sicher weiden“ ist keine bloße Vereinfachung, sondern eine ästhetische Transformation. Sie spiegelt sowohl die historische Rezeption Bachs als auch die sich wandelnden Ansprüche an musikalische Vermittlung. Ihre Analyse erlaubt Rückschlüsse auf Klangwahrnehmung, Gattungstransfer und kompositorische Essenz im Kontext der Transkription.
Im Spannungsfeld zwischen pastoraler Barockidylle und romantischer Innerlichkeit wird der Klavierauszug so zu einem Interpretationsdokument eigener Ordnung – weniger als Reproduktion, sondern als musikalischer Kommentar im Medium der Reduktion.
Anmerkungen
-
Vgl. Klaus Hofmann: Die Kantaten Johann Sebastian Bachs. Kassel: Bärenreiter, 2003, Bd. 1, S. 88–91.
-
Siehe David Schulenberg: The Keyboard Music of J. S. Bach. New York: Routledge, 2006, S. 212–214.
-
Vgl. Laurence Dreyfus: Bach and the Patterns of Invention. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996, S. 284 ff.