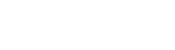Von Volker Seifert
Johann Sebastian Bachs Kantate Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd (BWV 208), gemeinhin als „Jagdkantate“ bezeichnet, entstand vermutlich 1713 anlässlich des Geburtstags von Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels (* 23. Februar jul. / 5. März 1682 greg. in Weißenfels; † 28. Juni 1736 in Sangerhausen) . Es handelt sich um eines der frühesten erhaltenen weltlichen Vokalwerke Bachs und zugleich um ein charakteristisches Beispiel für seine Fähigkeit, höfische Repräsentation mit mythologisch-allegorischem Personal und musikalischer Erfindungskraft zu verbinden.
I. Entstehungskontext und Funktion
 Die Kantate wurde am 23. Februar 1713 in Weißenfels uraufgeführt und entstand möglicherweise auf Anregung des Herzogs, der selbst passionierter Jäger war. Die Textvorlage stammt von Salomon Franck, dem Weimarer Hofdichter, dessen Zusammenarbeit mit Bach sich durch zahlreiche geistliche Werke zieht. Dass Bach hier ein weltliches Sujet aufgreift, steht im Dienst einer höfischen Huldigung, bei der die Jagd als Allegorie der Fürstentugend fungiert (1).
Die Kantate wurde am 23. Februar 1713 in Weißenfels uraufgeführt und entstand möglicherweise auf Anregung des Herzogs, der selbst passionierter Jäger war. Die Textvorlage stammt von Salomon Franck, dem Weimarer Hofdichter, dessen Zusammenarbeit mit Bach sich durch zahlreiche geistliche Werke zieht. Dass Bach hier ein weltliches Sujet aufgreift, steht im Dienst einer höfischen Huldigung, bei der die Jagd als Allegorie der Fürstentugend fungiert (1).
Das Werk stellt damit nicht nur eine musikalische Festrede dar, sondern ist ein Beispiel für die frühbarocke Form des Huldigungspasticcios, das sich verschiedener musikalischer Gattungen und symbolischer Figuren bedient, um eine politische oder soziale Botschaft zu vermitteln. Die Verwendung mythologischer Charaktere (Diana, Endymion, Pan, Pales) ist dabei typisch für die höfische Festkultur und vermittelt zugleich das Spannungsfeld zwischen Natur, Macht und Kultur.
II. Struktur und formale Anlage
Die Kantate umfasst insgesamt 15 Sätze, darunter vier Rezitative, zehn Arien bzw. Duette sowie einen abschließenden Chor. Die musikalische Sprache changiert dabei zwischen pastoraler Idyllik, tänzerischer Leichtigkeit und repräsentativer Pracht. Die Anlage folgt keinem liturgischen Schema, sondern ist dramaturgisch motiviert – der Wechsel von Arien und Rezitativen dient der Darstellung und Charakterisierung der mythologischen Figuren.
Abb. rechts: Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels im Jagdornat (Jakob Adolphi)
Die Instrumentation umfasst Oboen, Hörner, Streicher und Basso continuo – mit besonderem Gewicht auf den Hörnern, die die Jagdtopik klanglich präfigurieren. In dieser Besetzung liegt eine Besonderheit der Kantate: Es handelt sich um Bachs erstes bekanntes Werk mit Hörnern, womit er nicht nur ein damals modernes Instrumentarium einführt, sondern sich auch bewusst dem topischen Repertoire der Jagdmusik zuwendet (2).
III. Kompositorische Besonderheiten
1. Topos der Jagd in Musik und Text
Die Arie „Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd“ (Nr. 1) ist das programmatische Zentrum der Kantate. In der Vokalstimme (Sopran – als Diana) dominiert ein florider, tänzerischer Gestus, während die Hörner in virtuosen Intervallen das Jagdsignal imitieren. Der Satz steht in F-Dur, einer Tonart, die in barocker Affektenlehre häufig mit Festlichkeit und Helle assoziiert wird (3).
Die polyphone Verzahnung der Hörner mit den Streichern zeigt bereits Bachs Fähigkeit, den Tonmalereitopos in kontrapunktische Satztechnik zu überführen. Die Jagd wird nicht bloß evoziert, sondern kompositorisch strukturell verankert.
2. Charakterisierung durch Ariensprache
Bachs Fähigkeit zur musikalischen Charakterisierung zeigt sich etwa in der Arie „Ein Fürst ist seines Landes Pan“ (Nr. 9), gesungen von der Figur Pan (Bass). Hier wird ein rustikales, tänzerisches Idiom gepflegt, das durch einfache Harmonik und deutliche Periodik den pastor bonus allegorisiert. Der Bass vermittelt Autorität, Ruhe und Erdverbundenheit – eine ideelle Zuschreibung auf den Herzog selbst.
Ein Kontrast dazu ist die Arie „Schafe können sicher weiden“ (Nr. 9 – oft isoliert aufgeführt), gesungen von Pales (Alt). Hier überführt Bach das Thema der Fürsorge in einen pastoralen Stil, der durch seine Dreistimmigkeit mit obligater Blockflöte an barocke Hirtenmusiken erinnert. Die stilisierte Einfachheit und melodische Eleganz dieses Satzes stehen im Dienst eines idealisierten Herrscherbildes.
IV. Allegorie und rhetorische Strategien
Die Kantate verwendet allegorische Figuren zur personifizierten Tugendbeschreibung. Die mythologische Maske erlaubt Bach, in den einzelnen Arien rhetorische Affekte differenziert auszuschöpfen – gemäß der Affektenlehre. So ist jede Arie auf einen Affekt (Freude, Ruhe, Stärke etc.) hin komponiert, mit klar erkennbaren Stilmitteln wie Generalpausen, Melismatik oder motivischer Repetition.
Die Wiederkehr bestimmter musikalischer Gesten (z. B. Jagdsignale, Imitation von Naturlauten) in mehreren Sätzen erzeugt eine semantische Kohärenz, die über rein motivische Arbeit hinausgeht. Die Kantate operiert somit auch als Symbolkomposition, in der Musik Zeichencharakter erhält.
V. Bewertung und Kontextualisierung
Die Jagdkantate BWV 208 ist ein bedeutendes Beispiel für die Verbindung von Gelegenheitsschaffen, allegorischem Programm und musikalischer Substanz. Sie steht exemplarisch für Bachs Weimarer Zeit, in der er sich als Komponist profilierte, der höfische Repräsentation mit einer individuellen, stilistisch vielschichtigen Tonsprache verband.
Gleichzeitig ist das Werk ein Zeugnis für die damalige Praxis, Musik als Medium für politische Kommunikation zu verwenden. Dass Bach das Sujet der Jagd nicht bloß illustriert, sondern zu einer kompositorischen Reflexion über Macht, Ordnung und Natur formt, macht die Kantate zu einem Schlüsselwerk frühbacherischer Ausdrucksästhetik.
Anmerkungen
-
Vgl. Ulrich Siegele: „Zur Bedeutung der weltlichen Kantaten Johann Sebastian Bachs“, in: Bach-Jahrbuch, Bd. 49, Leipzig 1962, S. 50–71.
-
Vgl. John Eliot Gardiner: Music in the Castle of Heaven: A Portrait of Johann Sebastian Bach. London: Allen Lane, 2013, S. 176.
-
Vgl. Rita Steblin: A History of Key Characteristics in the Eighteenth and Early Nineteenth Centuries. Ann Arbor: UMI Research Press, 1983.