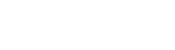Von Volker Seifert
Arthur Schopenhauers Mitleidsethik basiert auf der Annahme, dass moralisches Handeln aus einem unmittelbaren Mitgefühl mit dem Leid anderer entspringt. Er sieht Mitleid als die einzige wahre moralische Triebkraft, die den Egoismus überwindet und zur Gerechtigkeit sowie zur tätigen Nächstenliebe führt. Doch diese Ethik ist nicht ohne Kritik.
1. Psychologische Fragwürdigkeit des Mitleids als alleinige moralische Grundlage
Schopenhauer reduziert die Moral auf das Mitleid, was problematisch ist. Mitleid ist eine emotionale Regung, die subjektiv und unstet ist. Gefühle sind flüchtig und können durch äußere Umstände beeinflusst werden. Daher stellt sich die Frage, ob eine beständige und verlässliche Moral allein auf einem derart variablen Gefühl beruhen kann.
2. Fehlende normative Orientierung und Gefahr der Willkür
Wenn Mitleid der einzige moralische Maßstab ist, gibt es keine objektiven Prinzipien für richtiges Handeln. Ein Mensch könnte sich stärker mit einem leidenden Freund als mit einem leidenden Fremden verbunden fühlen und entsprechend unterschiedlich handeln. Ohne rationale Prinzipien, die über bloße emotionale Impulse hinausgehen, bleibt die Moral unberechenbar und potenziell willkürlich.
3. Mangel an universeller Geltung und Reichweite
Schopenhauer geht davon aus, dass Mitleid universell zugänglich ist. Doch nicht jeder Mensch empfindet in gleichem Maße Mitleid, und einige sind dazu gar nicht in der Lage (z. B. Menschen mit bestimmten psychischen Störungen). Wenn die Moral auf Mitleid basiert, sind diejenigen, die wenig oder kein Mitleid empfinden, moralisch ausgeschlossen. Eine tragfähige Ethik sollte jedoch für alle Menschen gelten, unabhängig von individuellen Empfindungen.
4. Problematische Konsequenzen für Ethik und Gerechtigkeit
Ein ausschließlich mitleidsbasierter Moralkodex könnte in bestimmten Situationen zu fragwürdigen moralischen Entscheidungen führen. Ein Richter, der sich von Mitleid mit einem Angeklagten leiten lässt, könnte ihn milder bestrafen, auch wenn es ungerecht wäre. Eine Gesellschaft, die auf Mitleid statt auf Prinzipien wie Gerechtigkeit und Rechte aufbaut, könnte in moralische Widersprüche geraten.
5. Fehlende Begründung für das Gute als Selbstzweck
Schopenhauers Ethik führt nicht zu einer allgemeinen Begründung, warum das Gute an sich erstrebenswert ist. Sie bleibt in einer emotionalen Reaktion verhaftet, anstatt eine universelle Begründung für moralisches Handeln zu liefern. Andere Ethiken, wie der Kategorische Imperativ Kants, bieten dagegen eine logisch ableitbare Begründung für moralisches Handeln.
Fazit
Schopenhauers Mitleidsethik hat den Verdienst, die Rolle der Empathie für moralisches Handeln zu betonen. Doch ihre Reduktion der Moral auf ein subjektives Gefühl macht sie anfällig für Willkür und unzureichend als universelle Ethik. Eine tragfähigere Moraltheorie müsste Mitleid mit rationalen Prinzipien und universellen Normen verbinden, um objektiver und beständiger zu sein.