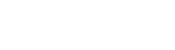Von Volker Seifert
Wer heute die Straßen beobachtet – wobei der Begriff „Straßenbild“ bereits zu großzügig ist –, erkennt ein Panorama modischer Verwahrlosung, das selbst hartgesottene Kulturpessimisten noch vor wenigen Jahrzehnten für satirische Übertreibung gehalten hätten. Jogginghosen im Restaurant, Kapuzenpullis im Theater, Funktionsjacken in der Kirche: Die Gegenwart zeigt einen Menschen, der seinen eigenen Anspruch längst aus den Augen verloren hat und dessen Kleidung nur noch eines signalisiert – die völlige Abwesenheit von Haltung.
Dieser gesellschaftliche Niedergang der Kleidung ist aber nicht nur ein ästhetisches Ärgernis. Er ist Symptom einer tieferliegenden Erosion: dem Verlust der Fähigkeit, zwischen Anlass und Alltäglichkeit zu unterscheiden. Kleidung war einst Sprache. Heute ist sie ein Grunzen.
Der Niedergang der Kleidung, den wir heute so beiläufig hinnehmen, wäre für frühere Generationen ein untrügliches Zeichen des kulturellen Verfalls gewesen. Ganze Epochen haben sich über Kleidung definiert, ihren Ernst, ihre Würde und ihren Anspruch darüber sichtbar gemacht. Man denke an die strenge Eleganz des 19. Jahrhunderts, an die britische Landhauskultur, deren Selbstverständnis sich gerade durch Kleidung ausdrückte, oder an die höfischen Gesellschaften Mitteleuropas, in denen man wusste, dass Haltung zuerst sichtbar und erst dann hörbar wird.
Der Mensch war – wie Ortega y Gasset es formulierte – immer ein wesenhaft gestimmtes Geschöpf, das sich selbst formt. Und Kleidung war ein Teil dieser Selbstformung.
Heute formt sie niemanden mehr; sie hängt nur noch lose am Menschen wie ein schlaffer Kommentar zu seiner Gleichgültigkeit.
Historische Wurzeln der jagdlichen Kleidung – und ihre moderne Verwässerung
 In der europäischen Jagdgeschichte war Kleidung niemals bloß dekorativ. Schon im Spätmittelalter unterschied sie zwischen sozialem Rang, jagdlicher Rolle und persönlicher Bereitschaft. Die höfischen Parforcejagden des Barock, die klassisch-britische Landjagd seit dem 18. Jahrhundert, aber auch die bürgerlichen Revierjagden des 19. Jahrhunderts – alle kannten einen Konsens:
In der europäischen Jagdgeschichte war Kleidung niemals bloß dekorativ. Schon im Spätmittelalter unterschied sie zwischen sozialem Rang, jagdlicher Rolle und persönlicher Bereitschaft. Die höfischen Parforcejagden des Barock, die klassisch-britische Landjagd seit dem 18. Jahrhundert, aber auch die bürgerlichen Revierjagden des 19. Jahrhunderts – alle kannten einen Konsens:
Die Jagd ist ein Anlass, der eine äußerlich sichtbare Haltung erfordert.
Darum trug man:
- Loden, weil er schweigsam ist.
- Schurwolle, weil sie schützt, ohne sich aufzudrängen.
- Tweed, weil er Teil eines kultivierten Lebensstils wurde – nicht bloß ein Stoff.
- Leder, weil es ein Zeichen von Dauer und Erfahrung ist.
Man brachte sich damit nicht in Pose, sondern in einen kulturellen Zusammenhang. Man stellte sich nicht selbst dar, sondern stellte sich in die Reihe derer, die vor einem jagten.
Bild rechts: Fritz Möritz "Jagdgesellschaft im Winter",
Heute hingegen?
Outdoorjacken wie aus dem Ausverkauf, Funktionsmaterialien, die jede Würde verloren haben, und Farben, die eher mit dem innerstädtischen Baumarkt korrespondieren als mit jagdlicher Tradition.
Was die alten Kulturen wussten:
Kleidung adelt nicht den Menschen – sie verpflichtet ihn.
Was die Moderne glaubt:
Kleidung müsse nichts weiter tun, als bequem sein.
Der Verlust der Form – ein Spiegel des Verlusts der inneren Ordnung
Brillat-Savarin sprach über die Gastronomie stets davon, dass äußere Form den inneren Zustand einer Kultur spiegelt. Was er für die Küche beschrieben hat, gilt ebenso für die Kleidung – und in verschärftem Maße für die Jagd.
Die äußere Form zerfällt, wenn:
- das Bewusstsein für Tradition schwindet,
- die Fähigkeit zur feierlichen Geste verschwindet,
- die Ernsthaftigkeit durch Bequemlichkeit ersetzt wird.
Die heutige Freizeitkleidung auf Gesellschaftsjagden ist darum kein modischer Lapsus, sondern eine kulturelle Kapitulation. Sie sagt:
„Ich bin nicht bereit, mich der Tradition unterzuordnen. Ich möchte die Jagd nach meinem Komfort gestalten.“
Doch eine Jagd, die sich dem Komfortdenken unterwirft, ist keine Jagd mehr, sondern ein Event. Und Events produzieren keine Kultur – sie konsumieren sie.
Britische Jagdkultur als Kontrastfolie
Nirgends zeigt sich die Bedeutung der Kleidung so klar wie auf den britischen Inseln. Dort ist Jagdbekleidung kein museales Ritual, sondern gelebte Selbstachtung. Tweed, Wachsjacke, Krawatte und Schießweste sind weniger Mode als moralischer Rahmen. Sie bilden einen Kanon, der nicht von oben verordnet wird, sondern aus einem tiefen Verständnis erwächst:
Die Jagd verlangt vom Jäger mehr als Funktion. Sie verlangt Stil, Disziplin und soziale Rücksicht.
Dasselbe gilt für Deutschland – nur vergessen wir es zunehmend. Wir ersetzen kultivierten Dress durch Outdoor-Neutralität. Wir verwechseln Zweckmäßigkeit mit Entschuldigung. Und während die Briten wissen, dass Kleidung Teil der jagdlichen Gesellschaft ist, behandeln hierzulande manche die Jagd, als seien sie allein im Wald unterwegs – oder schlimmer: als seien sie beim Samstagseinkauf.
Spenglers Diagnose: Der Mensch zerfällt, wenn die Form zerfällt
Oswald Spengler schrieb, dass Kulturen sterben, wenn sie ihren Stil verlieren. Nicht ihre Technik, nicht ihre Macht – ihren Stil. Man könnte hinzufügen:
Wenn die Kleidung eines Volkes gleichgültig wird, wird auch das Volk gleichgültig gegenüber sich selbst.
Die Jagd ist einer der letzten Räume, in denen Stil, Form, Disziplin und Ritual noch erkennbar sind. Doch auch hier greift der Zeitgeist um sich – und der Zeitgeist ist bequem, laut und ohne Ehrfurcht.
Ein Schlusswort, das bewusst überzeichnet – weil es notwendig ist
Wer auf einer Gesellschaftsjagd auftaucht wie zum Waldspaziergang, der bricht nicht nur die Etikette – er missversteht das Wesen der Jagd.
Denn die Jagd ist keine Kulisse für Freizeitkleidung.
Sie ist ein Raum kultureller Verdichtung.
Und wer diesen Raum betritt, ohne sich ihm entsprechend zu kleiden, der zeigt nicht Individualität, sondern Ignoranz.
Vielleicht markiert die Kleidung nur Stoffschichten.
Doch unter diesen Stoffschichten zeigt sich, wie sehr ein Mensch die Jagd – und damit die Kultur – ernst nimmt.