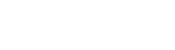Von Christoph Boll
Von der Antike bis zur Urbanisierung, von der höfischen Angelegenheit zu aktuellen gesellschaftlichen Konflikten: Jagd und Jäger, Wild und Wald im Spiegel der Literatur im jeweiligen Zeitgeist und der Wirklichkeit. Eine Serie für „natur+mensch“.

Mit der Aufklärung hat sich der Blick auf die Welt geändert. Die bürgerliche Gesellschaft mit ihren sozialen Verwerfungen und Konflikten rückt zunehmend in das Zentrum der Betrachtung. So zielt auch August Wilhelm Ifflands Stück „Die Jäger. Ein ländliches Sittengemälde“ (1785) mit seiner Kritik am Luxus und der Verkennung natürlicher Lebensrhythmen auf das Gute. Im Mittelpunkt des Geschehens steht die Familie des Oberförsters Gottfried Warberger zu Weißenburg. Sie ist der Inbegriff der Redlichkeit auf allen Ebenen. Das Stück wurde im ganzen deutschen Sprachraum erfolgreich, nachdem Goethe es zur Neueröffnung des Weimarer Hoftheaters 1791 gewählt hatte. Goethe selbst setzt diese Stoßrichtung fort mit seiner Erzählung „Novelle“ (1828). Er hatte sie bereits 1797 unter dem Titel „Die Jagd“ entworfen. Dort geht es um eine ganz neue Art zu jagen: Die Geschichte geht nicht vom Beutemachen aus, sondern von der Erziehung des jungen Jägers zu Selbstbeherrschung und Identifikation mit dem Jagdobjekt. Trieb und Verstand, Instinkt und Wille werden harmonisiert. Dieses Ideal ist nun das höhere Jagdziel, das noch heute in mancher (Jung-)Jäger-Belehrung als Ethos anklingt.
Dem entspricht, dass der Leser der Grimmschen, aber auch anderer Märchen sehr selten erfährt, welchem Wild der Jäger nachstellt. Joseph von Eichendorff formuliert es euphorisch: „Aus der Büchse sprühend Funken! Immer höher schwillt die Brust! Wild und Jäger todestrunken. In die grüne Nacht versunken – O du schöne Jägerslust!“ In den Sagen und Märchen ist das Tier nur wichtig, wenn es Ungeheuer oder andere Plagen sind, die die Menschen bedrohen und die die Jagenden bezwingen. Dass sie dabei auch fantastische, geheimnisvolle oder gar zauberhafte Waffen wie einen schwarzen Spieß oder eine Windbüchse einsetzen, niemals vorbei und sogar um die Ecke schießen können, gehört eben zur Welt der Märchen – oder anders gesagt in das weite Feld des Jägerlateins.
Verwundbarkeit von Flora und Fauna nicht ausblenden
Doch Jäger sind keine Phantasten. Aber in der weiteren Historie ist ihr sozialer Abstieg unaufhaltsam, sowohl in der literarischen als auch in der realen Welt. Anette von Droste-Hülshoff weiß um 1840 in ihrem Gedicht „Am Turm“ immerhin noch eine klare Rangfolge zu benennen: „Wär´ ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten, wär ich ein Mann doch mindestens nur, …“
Jäger ist also immer noch mehr als Mann oder Soldat. Er ist das Sinnbild des selbstbestimmten Menschen. Doch damit ist es an der Wende zum 20. Jahrhundert ebenso vorbei wie mit dem empathischen Einssein des Menschen mit der Natur. Der bekannte Jäger-Schriftsteller Hermann Löns beschwört zwar noch die Jagd als Heimat und Erfüllung der Sehnsucht nach Authentizität. Zugleich kann er sich der kühlen naturwissenschaftlichen Rationalität nicht mehr entziehen und die Verwundbarkeit von Flora und Fauna nicht ausblenden. Er wird zum frühen Verfechter des Naturschutzes und zugleich zum Vorläufer all jener, die bis heute die Hege als Auftrag verstehen, in einer vom Menschen gestalteten Umwelt dem Wild und seinem Lebensraum zum Recht zu verhelfen.
Dieter Stahmann, ehemaliger Vorsitzender des Forums lebendige Jagdkultur, hat in seinem Beitrag „Den Worten auf der Spur“ im Sonderheft „Die Jagd“ der Zeitschrift WILD UND HUND diesen Zweispalt beschrieben. Nach dem Abbruch des Biologie-Studiums lehnt Löns „in seinen späteren Jahren sogar die Darwin´sche Evolutionstheorie ab, weil er sich seine Wunder der Natur nicht durch abstraktes Denken zerstören lassen wollte“. Löns begreift dabei den Menschen als elementaren Bestandteil der Natur, nicht als Fremdkörper.
Immer diese grässlichen Jagdgeschichten
Der aus einem Försterhaushalt stammende Ludwig Thoma, der zunächst selbst den Beruf des Vaters ergreifen wollte und Jäger war, kann selbst in seinem literarischen Werk die Kluft nicht mehr überwinden. „Nein! Dass der gemütliche Nachmittag so gestört werden musste! Immer diese grässlichen Jagdgeschichten!“, heißt es in der 1921 veröffentlichten Erzählung „Der Jagerloisl. Eine Tegernseer Geschichte“. So klagt die aus der Weltstadt Berlin stammende (zugereiste) selbstbewusste Henny Fehse. Für sie und ihre Familie ist der Titelheld längst nicht mehr der Vornehme, sondern er verkörpert das „Derbe“. Sie spricht gar davon, es gehe zu „wie bei den Wilden“. Der Loisl aber vertritt eine Passion, die Henny nie nachvollziehen kann: „i red von der richtigen Jagerei, net vom Umanandschieß’n und Schind’n und Umbringa, was Haar und Federn hat“.
So sehr Thoma auch den bodenständigen jungen Mann als Naturideal glorifiziert, so sehr kann er den gesellschaftlichen Gegenentwurf des urbanen Bürgertums nicht mehr ausblenden. Damit deutet sich zugleich die Wandlung von Natur und der damit verbundenen Jagd als Zentrum des Seins zum Abseitigen, Hinterwäldlerischen an, das sogar im Exzess der zügellosen Sportjagd enden kann. Die ganz überwiegende Mehrheit der aufgeklärten Menschen hat sich heute ganz und gar von der romantischen Sichtweise entfernt. Eine emphatische literarische Naturbeschreibung und Jagdschilderung nehmen sie als Kitsch wahr. Und sie ist es wohl auch, solange sie vordergründig und allein schwärmerisch bleibt. Eine Ursache mag sein, dass die Autoren die Jagd kaum noch in Kategorien und Begriffen vermitteln können, die eine breite Öffentlichkeit versteht – sei es aus schriftstellerischem Mangel oder weil es Verständnis-Defizite auf Seiten der Leser gibt. Zu konstatieren bleibt allemal: Jäger und Nichtjäger sprechen nicht – oder nicht mehr – dieselbe Sprache. Ab dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts wird dieser Themenbereich deshalb literarisch immer schwerer darstellbar, bis er ab den 1970er Jahren nahezu obsolet wird.
Quelle: „natur+mensch“