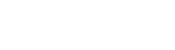Von Prof. Dr. Johannes Dieberger
In diesem Teil des geschichtlichen Rückblicks auf die Entstehung und den Werdegang des St. Hubertus zeigt uns der Autor die Veränderungen der Gesellschaft zur Jagd, deren Auswüchse und die der damaligen Zeit gemäßen Einstellungen und Auffassungen auf.
Hochblüte der Auerwildjagd
 Auch eine zweite Federwildart wurde durch die menschlichen Veränderungen des Lebensraums gefördert. Die naturferne Forstwirtschaft der Bauern mit Streurechen und Schneiteln (das ist die Nutzung der unteren Äste der Nadelbäume als Einstreu für das Vieh) erzeugte in den Waldbeständen unnatürliche Strukturen, die dem Auerwild besonders zusagten. Der Bestand dieser Wildart hatte dadurch bedeutend zugenommen, sodass jährlich hohe Zahlen von Auerhähnen und -hennen nachhaltig erlegt werden konnten. Aus dem steirischen Revier Liesing des Grafen Silva-Tarouca - dem Autor des bekannten Buches "Kein Heger, kein Jäger" - ist ein Foto aus dem Jahr 1914 erhalten geblieben, das den Grafen mit Jagdfreunden zeigt, die an einem Balzmorgen 24 Auerhähne erlegt hatten. (siehe Bild rechts) In dem selben Jagdgebiet konnten an den Tagen davor und danach noch einige große Hähne erbeutet werden, ohne das der Bestand dadurch beeinträchtigt wurde.
Auch eine zweite Federwildart wurde durch die menschlichen Veränderungen des Lebensraums gefördert. Die naturferne Forstwirtschaft der Bauern mit Streurechen und Schneiteln (das ist die Nutzung der unteren Äste der Nadelbäume als Einstreu für das Vieh) erzeugte in den Waldbeständen unnatürliche Strukturen, die dem Auerwild besonders zusagten. Der Bestand dieser Wildart hatte dadurch bedeutend zugenommen, sodass jährlich hohe Zahlen von Auerhähnen und -hennen nachhaltig erlegt werden konnten. Aus dem steirischen Revier Liesing des Grafen Silva-Tarouca - dem Autor des bekannten Buches "Kein Heger, kein Jäger" - ist ein Foto aus dem Jahr 1914 erhalten geblieben, das den Grafen mit Jagdfreunden zeigt, die an einem Balzmorgen 24 Auerhähne erlegt hatten. (siehe Bild rechts) In dem selben Jagdgebiet konnten an den Tagen davor und danach noch einige große Hähne erbeutet werden, ohne das der Bestand dadurch beeinträchtigt wurde.
Daneben wurde das Auerwild vor hundert Jahren im Herbst noch ein zweites Mal bejagt, wenn die Jungvögel schon voll ausgewachsen waren. Dazu suchte man mit einem Stöberhund im Wald nach den noch wenig erfahrenen Hühnern. Wenn der Hund an sie herankam und Laut gab, strichen die jungen Exemplare auf die nächsten Bäume und betrachteten die Situation von oben. Die erfahrenen Altvögel strichen auf größere Entfernung ab und brachten sich so in Sicherheit. Der Jäger konnte dann leicht die aufgebaumten Jungvögel von den nächsten Bäumen schießen, wobei man Hähne und Hennen erlegte. Durch die Nutzung der Jungvögel war der Eingriff in den Auerhahnbestand unbedeutend, da vom diesjährigen Nachwuchs dieses Federwildes auch ohne menschlichen Eingriff bis über den Winter mind. 50 % - bedingt durch andere Faktoren - ausfallen müssen.
Ausrottung vs. Gatter
Die Landwirtschaft hatte am Land Vorrang vor allen anderen Interessen. Daher gab es in den mitteleuropäischen Kulturländern bereits Wildschadensgesetze, wodurch Jagdpächter oft horrende Entschädigungen zu bezahlen hatten. Wildparks und Tiergärten hatte man früher aus Liebhaberei eingerichtet. Nunmehr wurde aus wirtschaftlichen Gründen von mehreren Autoren empfohlen, ein Waldstück zu erwerben und es dort mit einer eingefriedeten Wildbahn zu versuchen.
Ernst Ritter von Dombrowski verfasste 1898 ein jagdwirtschaftliche Studie über "die eingefriedete Wildbahn als Ideal eines Hochwildrevieres in den Kulturländern". Darin stellt er fest: "Am schlimmsten liegen die Verhältnisse in jenen Kulturstaaten, deren verschiedene Wilschadensgesetze lediglich einem mehrfachen Millionär das Vergnügen eines eigenen freien Hochwildbestandes gestatten und in denen auch solche Glückliche der Gefahr ausgesetzt bleiben, dass eines schönen Tages infolge der Klagen der Anrainer in ihren mühsam gehegten Revieren von amtswegen Polizeijagden abgehalten werden". Nach Ansicht von Dombrowski gibt es in den meisten Fällen dann nur die Alternative eines gänzlichen Abschusses oder einer Einfriedung, Viele Jaǵdherren wählten damals den Totalabschuss des Schalenwildes und kauften in den Karparten eine Waldherrschaft zum Ersatz für die verlorene Jagdmöglichkeit. Doch auch dieser Ausweg bot nur begrenzte Möglichkeiten.
Zäunung billiger als Wildschaden
Dombrowski empfahl die Einfriedung eines freien Rotwildbestandes, wenn dieser unhaltbar wurde. Dies war aber nur sinnvoll, wenn festgestellt werden konnte, das innerhalb des Geheges die Existenzbedingungen für das Wild größtenteils auf natürliche Weise erfüllt werden können. Wäre die Erhaltung zum überwiegenden Teil nur auf künstliche Wege durchführbar, müsse man sich mit einem ganz minimalen Wildbestand begnügen oder schieße das Wild lieber gänzlich ab, satt es bei ungeheuren Kosten langsam, aber sicher verkümmern zu lassen. Der Autor versichert, dass in einem günstigen Habitat unter beibehaltung des vorherigen Wildbestandes für die Einzäunung und den Betrieb des Wildgatters nur zehn bis 50 % der Kosten, die Wildschadensabgeltung ausmachen, aufzuwenden wären. Der Nachbar kann in einer eingefriedeten Wildbahn keine Zukunftsstücke wegschießen, dagegen hat man die Regulierung und den Wahlabschuss vollkommen in der Hand, daher schien dem Autor die Eingatterung der Hochwildbahnen in einem so idealen Lichte, dass er nur dazu raten konnte. Diese Bedingungen gelten heute nach mehr als hundert Jahren nicht mehr, da die enormen Zaunkosten nur bei einem wesentlich überhöhten Wildbestand tragbar werden. Damal wusste man noch nicht viel von genetischen Minimalpopulationen. Die Wildzucht in der eingefriedeten und in der freien Wildbahn versuchte man damal nach landwirtschaftlichen Grundsätzen zu vollziehen.
(Fortsetzung folgt)
Erstabdruck: St. Hubertus, 3/2002, S. 17ff.