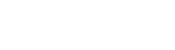Von Volker Seifert
Es gehört zu den großen Tugenden Loriots, dass er Milieus nicht denunziert, sondern entblößt – und zwar mit einer Höflichkeit, die schmerzhafter sein kann als jede Grobheit. Sein Jäger, der eine Bekannte in den Wald führt, ist keine Karikatur des Waidmanns, sondern eine Studie über Selbstverständnis, Sprache und jene feine Eitelkeit, die auch vor dem Revier nicht Halt macht.
Die Szene lebt vom Kontrast: Hier der Wald, schweigend, in sich ruhend; dort der Mann, der erklärt. Er deutet jedes Rascheln, bestimmt jedes Blatt im Vorübergehen und versieht das Unscheinbare mit terminologischer Würde. Seine Begleiterin hört zu – höflich, vielleicht mit jenem leisen Staunen, das entsteht, wenn Leidenschaft und Selbstdarstellung ununterscheidbar werden.
Der eigentliche Höhepunkt ereignet sich in einer Rast. Der Jäger breitet sein Butterbrot aus, um es mit der Dame zu teilen – ein Akt der Fürsorge, beinahe galant. Doch das Schicksal greift ein: Das Brot fällt, unglücklicherweise mit der Wurstseite nach unten, genau auf eine Ansammlung kleiner, dunkler Kügelchen. Kein Aufschrei, kein Ekel. Stattdessen prüfender Blick, gefolgt von der ruhigen Feststellung:
„Das ist die Losung eines dreijährigen Rammlers.“
Hier verdichtet sich Loriots Kunst: Die Situation wäre für sich genommen banal-komisch. Doch die Größe liegt in der Reaktion. Während er mit bedächtiger Sorgfalt die Köttel vom Brot wischt, erläutert der Jäger sachlich:
„Kaninchen sind Vegetarier.“
Die Sprache wird hier zum Rettungsring. Der Jäger ordnet, bestimmt, erklärt – selbst in einer peinlichen Lage – und verwandelt einen kleinen Unfall in naturkundliche Lektion. Die Natur bleibt unbeeinflusst, der Wald urteilt nicht; nur der Mensch inszeniert sich.
Und gerade hierin zeigt sich Loriots feiner Blick auf die Unbeholfenheit im Umgang mit der Weiblichkeit. Die Begleiterin fungiert nicht als eigenständiges Gegenüber, sondern als Publikum, das belehrt werden muss. Der Jäger weiß nicht, wie Nähe funktioniert, außer über Fachwissen, Aufmerksamkeit und korrektes Verhalten. Er bleibt in der Rolle des Dozenten, nicht des Gefährten. Seine Galanterie ist mechanisch; sie folgt Konventionen, ohne Wärme zu entfalten. Die reale Frau neben ihm bleibt ihm fremd, und aus dieser Fremdheit erwächst jene leise Komik, die Loriots Werk durchzieht.
Die Jagd erscheint weniger als Handlung, sondern als Haltung. Der Mann führt nicht nur durch den Wald; er führt vor. Er zeigt, erläutert, deutet. Sein Wissen über die Natur, seine präzisen Klassifikationen, die selbst das beschmutzte Butterbrot nicht entwerten können, sind Ausdruck einer Sehnsucht nach Kontrolle – und gleichzeitig Spiegel bürgerlicher Selbstüberschätzung. Die weibliche Begleiterin fungiert als stiller Korrektiv: Ihre ruhige Skepsis kontrastiert mit der überbordenden Autorität des Jägers, ohne dass die Szene je derb wird.
So wird aus einem beschmutzten Butterbrot, aus einem scheinbar lächerlichen Moment, eine kleine Parabel über Würde, Selbsttäuschung und die feine Kunst der Beobachtung. Loriot zeigt, dass wahre Komik nicht aus Übertreibung entsteht, sondern aus der Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, aus der Pedanterie des Menschen in der Begegnung mit Natur und Mitmensch. Der Wald bleibt schweigend, die Kaninchen losungstreu, und der Jäger – bemüht, korrekt und unbeholfen zugleich – offenbart das, was menschliches Verhalten im Revier so unverwechselbar macht.
Vielleicht liegt gerade darin die bleibende Qualität des Sketches: Die Jagd wird zum Spiegel der bürgerlichen Selbstinszenierung, die Unbeholfenheit im Umgang mit der Weiblichkeit zeigt, wie sehr wir unsere Rollen ernst nehmen, selbst wenn die Welt um uns herum still und unbeeindruckt bleibt. Loriots Humor trifft hier auf das, was zeitlos ist: die Mischung aus Ernst, Pedanterie und der leisen Ironie, die allein genügt, um menschliche Schwächen charmant sichtbar zu machen.