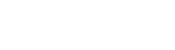Von Volker Seifert
Ein Beitrag zur Kontemplation im jagdlichen Selbstverständnis
Die moderne Welt ist geprägt von einem tiefgreifenden Wunsch nach Kontrolle, Planbarkeit und technischer Verfügbarkeit. Dieser Drang durchzieht nicht nur Ökonomie und Wissenschaft, sondern auch unser Verhältnis zur Natur. Hartmut Rosa, Soziologe und Vertreter der sogenannten Resonanztheorie, hält in seinem Essay Unverfügbarkeit dagegen: Nicht Kontrolle, sondern Offenheit gegenüber dem Unverfügbaren sei der Schlüssel zu einem gelingenden Leben – und damit auch zu einem resonanten Weltverhältnis.1
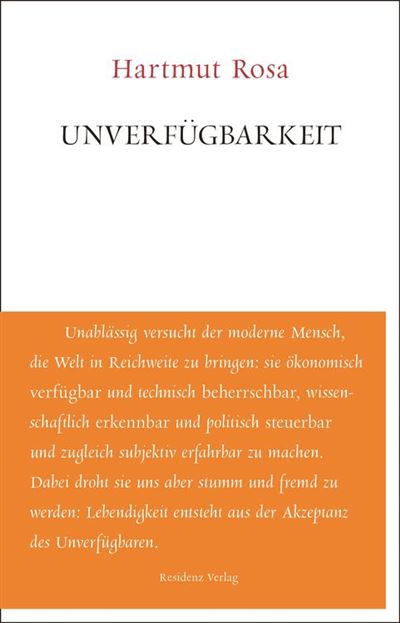 Rosas Überlegungen treffen auf die Jagd in besonderer Weise zu. Die Jagd – zumindest in ihrer kulturell verankerten, ethisch durchdachten Form – widersetzt sich dem Ideal der Verfügbarkeit. Zwar operiert sie mit Werkzeugen, Planung und Wissen, aber ihr Gelingen entzieht sich stets der vollständigen Kontrolle. Sie ist, in Rosas Worten, ein „resonantes Geschehen“: ein Vorgang, in dem sich der Mensch auf die Natur einlässt, auf ein Gegenüber, das nicht restlos beherrschbar ist.2
Rosas Überlegungen treffen auf die Jagd in besonderer Weise zu. Die Jagd – zumindest in ihrer kulturell verankerten, ethisch durchdachten Form – widersetzt sich dem Ideal der Verfügbarkeit. Zwar operiert sie mit Werkzeugen, Planung und Wissen, aber ihr Gelingen entzieht sich stets der vollständigen Kontrolle. Sie ist, in Rosas Worten, ein „resonantes Geschehen“: ein Vorgang, in dem sich der Mensch auf die Natur einlässt, auf ein Gegenüber, das nicht restlos beherrschbar ist.2
Unverfügbarkeit als kulturelles Gegenmodell
Rosa beschreibt vier Formen der Unverfügbarkeit: die Unverfügbarkeit des Gelingens, die Unverfügbarkeit der Begegnung, die Unverfügbarkeit der Verfügbarkeit selbst sowie die existenzielle Unverfügbarkeit des Todes. 3 Alle vier berühren die Jagd. So kann kein Jäger das Gelingen eines Ansitzes garantieren – Wild erscheint, oder es erscheint nicht. Selbst bei aller Vorbereitung bleibt der Erfolg offen. Diese Offenheit ist nicht Defizit, sondern Essenz der jagdlichen Erfahrung.
Auch die Begegnung mit dem Wildtier lässt sich nicht erzwingen. Der berühmte Moment, in dem Blickkontakt entsteht, in dem der Mensch plötzlich als Teil des Waldes erlebt wird, ist ein Geschenk, nicht ein Resultat menschlicher Machtausübung. Hier offenbart sich die Jagd als Erfahrungsraum echter Resonanz – im Sinne Rosas eine „Antwortbeziehung“, in der beide Seiten in ein lebendiges Wechselspiel treten.4
Resonanz statt Kontrolle: Die Jagd als Widerstand gegen Beschleunigung
Ein zentrales Motiv in Rosas Gesamtwerk ist die Diagnose einer „Beschleunigungsgesellschaft“, die durch ständigen Wachstumszwang, Effizienzdenken und Verdichtung von Zeitstrukturen geprägt ist. 5 Jagd steht diesem Impuls diametral entgegen. Sie verlangt Geduld, Stille, Langsamkeit. Der Jäger kann das Wild nicht hetzen, er muss warten. In dieser Geduld liegt eine Schulung des Selbst, eine Schule der Demut.
Jagd in Rosas Sinn ist deshalb auch ein kultureller Gegenentwurf zur Technosphäre, die alles verfügbar machen will. Wild lässt sich nicht züchten wie Nutzvieh, nicht programmieren wie Maschinen. In einer Welt, die zunehmend algorithmisiert wird, ist das Einlassen auf das Unplanbare, wie es die Jagd verlangt, ein Akt der Bewahrung kultureller Tiefe.
Jagd als Antwort auf das Verstummen der Welt
Rosa beschreibt die moderne Krise auch als ein „Verstummen der Welt“: Die Dinge, Tiere, Menschen antworten uns nicht mehr, sie verweigern sich echter Beziehung. 6 Die Jagd – verstanden nicht als bloßer Akt des Tötens, sondern als rituell gerahmte Praxis – kann ein Raum sein, in dem Welt wieder spricht. Der Wind im Hochsitz, das Knacken eines Zweigs, das plötzliche Auftauchen eines Rehs – all das sind Momente, in denen Welt antwortet.
Doch diese Antwort kommt nicht auf Knopfdruck. Sie verlangt eine Haltung des Lauschens, des Respekts – kurz: eine Haltung, die Rosas Begriff der Resonanz entspricht. Jagd wird so zur Übung in Unverfügbarkeit, zum Schutzraum gegen den Zugriff des Technischen.
Fazit
Rosas Unverfügbarkeit ist kein jagdtheoretischer Text, aber seine Philosophie trifft die Jagd ins Herz. Wo sie nicht zum Mittel des Managements degradiert wird, sondern als Begegnung und Beziehung gedacht ist, eröffnet sie jene Resonanzräume, die der modernen Welt zunehmend abhandenkommen. Wer jagt, kann – wenn er sich einlässt – erleben, was Rosa beschreibt: dass Welt nicht gemacht, sondern empfangen werden will.
In diesem Sinn bleibt die Jagd ein kulturelles Bollwerk gegen die Totalverfügbarkeit. Nicht durch Macht, sondern durch Achtsamkeit wird sie zur Schule eines resonanten Lebens.
Fußnoten
- Hartmut Rosa: Unverfügbarkeit. Wien: Paul Zsolnay Verlag, 2020, S. 11f.
- Ebd., S. 23.
- Ebd., S. 30–45.
- Vgl. Hartmut Rosa: Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2016, S. 298ff.
- Vgl. Hartmut Rosa: Beschleunigung und Entfremdung, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2013.
- Rosa: Unverfügbarkeit, S. 66.