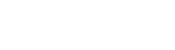Von Volker Seifert
1. Einleitung
Arthur Schopenhauer (* 22. Februar 1788 in Danzig; † 21. September 1860 in Frankfurt am Main) gilt als einer der bedeutendsten Philosophen des 19. Jahrhunderts, dessen Denken stark von Immanuel Kant und der indischen Philosophie beeinflusst wurde. Besonders seine metaphysische Konzeption des Willens und seine Ethik des Mitleids haben weitreichende Implikationen für das Naturverständnis und die moralische Bewertung der Jagd. In dieser Abhandlung wird zunächst Schopenhauers Naturbegriff erörtert, seine Mitleidsethik dargestellt und daraufhin untersucht, welche Konsequenzen diese für die Praxis der Jagd haben.
2. Der Naturbegriff bei Schopenhauer
Schopenhauer versteht die Natur nicht als bloßes mechanistisches System, wie es im Rahmen der klassischen Naturwissenschaften betrachtet wurde, sondern als eine Manifestation des metaphysischen Willens. Dieser Wille ist ein blinder, unstillbarer Trieb, der sich in allen Naturerscheinungen ausdrückt. So heißt es in seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung (Erster Band, 1819, Zweiter Band s. u. 1844):
"Die Natur ist die sichtbare Erscheinung des Willens zum Leben."
Dieser Wille zum Leben ist das fundamentale Prinzip, das alles Seiende durchdringt und in der gesamten Natur wirksam ist. Pflanzen, Tiere und Menschen sind verschiedene Stufen der Objektivation dieses Willens. Die Naturgesetze sind demnach nicht einfach zufällige Regelmäßigkeiten, sondern Ausdruck der unbewussten, ziellosen und oft grausamen Triebkräfte des Willens.
Da die Natur als Wille auf Selbsterhaltung und Fortpflanzung ausgerichtet ist, geht sie oft rücksichtslos vor. Dies zeigt sich insbesondere im Kampf ums Dasein, in dem sich Stärkere gegen Schwächere durchsetzen. Das Dasein der Natur ist also von einem inhärenten Leiden geprägt.
3. Die Ethik des Mitleids
Schopenhauers Ethik fußt auf der Erkenntnis, dass alle Lebewesen Ausdruck desselben metaphysischen Willens sind. Daraus leitet er eine fundamentale moralische Verpflichtung zum Mitleid ab. Er argumentiert, dass das Individuum durch die intuitive Einsicht in die Einheit des Willens auch das Leiden anderer Lebewesen als sein eigenes erkennen kann:
"Das Mitleid ist die Grundlage der Moral."
Diese Einsicht führt zu einer ethischen Haltung, die Gewalt und Leid vermeidet, wann immer es möglich ist. Schopenhauer hebt insbesondere hervor, dass Tiere dieselben Leidensfähigkeiten wie Menschen besitzen und daher moralisch berücksichtigt werden müssen. Daraus folgt eine starke Kritik an jeglicher Form von Tierquälerei, unnötiger Tötung und Ausbeutung.
4. Anwendung auf die Jagd
Wenn man Schopenhauers Philosophie auf die Jagd anwendet, ergibt sich eine grundsätzliche Ablehnung dieser Praxis. Da die Jagd nicht nur das Leben von Tieren beendet, sondern auch erhebliches Leid verursacht, steht sie im Widerspruch zu seiner Mitleidsethik.
4.1. Die Jagd als Ausdruck des blinden Willens
Jäger handeln oft aus einem instinktiven, tief verwurzelten Trieb, Beute zu machen. Dies ist aus schopenhauerischer Sicht nichts anderes als eine besonders rohe Form des Willens, die sich in der Natur manifestiert. Doch der Mensch, als vernunftbegabtes Wesen, ist in der Lage, diesen blinden Willen zu überwinden und stattdessen nach moralischen Prinzipien zu handeln.
4.2. Sport- und Trophäenjagd
Besonders verwerflich erscheint Schopenhauer die Jagd aus Vergnügen oder zur Demonstration von Macht. Die Sportjagd ist ein Beispiel für menschliche Grausamkeit und mangelndes Mitleid. In seinen Schriften äußert sich Schopenhauer scharf gegen Tierquälerei und vergleicht Menschen, die Tiere quälen, mit moralisch verwahrlosten Individuen.
4.3. Jagd zur Nahrungsbeschaffung
Eine mögliche Rechtfertigung könnte sein, dass die Jagd zur Nahrungsbeschaffung notwendig ist. In vorindustriellen Gesellschaften mag dies zutreffen, doch Schopenhauer betont, dass der Mensch als moralisches Wesen stets nach der Option mit dem geringsten Leid suchen sollte. In der modernen Welt, in der tierleidfreie Alternativen existieren, wäre die Jagd daher nicht moralisch vertretbar.
4.4. Die Rolle des Menschen gegenüber der Natur
Schopenhauer fordert eine moralische Haltung gegenüber allen Lebewesen. Da der Mensch die Fähigkeit besitzt, Mitleid zu empfinden, sollte er nicht als Zerstörer der Natur auftreten, sondern als Beschützer. Dies bedeutet, dass er, wann immer möglich, auf Gewalt verzichten und einen respektvollen Umgang mit der Natur pflegen sollte.
5. Fazit
Schopenhauers Naturphilosophie und Mitleidsethik liefern eine eindeutige Grundlage für die Ablehnung der Jagd. Die Natur wird als blinder Wille verstanden, der zwar Leiden hervorbringt, den der Mensch jedoch durch seine moralischen Einsichten überwinden kann. Da Mitleid das höchste moralische Prinzip ist, ist jede Form der Jagd, die vermeidbares Leid verursacht, ethisch nicht vertretbar. Schopenhauers Philosophie ermutigt den Menschen dazu, sich seiner Verantwortung gegenüber der Natur bewusst zu werden und tierfreundliche Alternativen zu suchen.