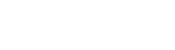Dr. Bertram Georgii
Bis ins letzte Jahrhundert war die Sicht auf Tiere eine rein anthropozentrische. Zu verlockend für unseren Umgang mit Natur klang die Genesis 1,28 (der Lutherübersetzung zufolge): „Macht euch die Erde untertan und herrschet über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels, über das Vieh und alles Getier, das auf Erden kriecht“ - hier der Mensch als Krone der Schöpfung, dort das Tier als unbegrenzt nutzbare bloße Ressource.
Ein fatales Missverständnis! Aber tempi passati. Wie sieht es mit dem Verhältnis Mensch-Tier nach heutiger Auffassung aus? Hier der Versuch einer Antwort aus Sicht der Tierethik.
Denn mittlerweile haben Verhaltensbiologen, Tierpsychologen und Tierethiker eine sehr andere Sicht auf Tiere entwickelt. So hat sich gezeigt, dass sich die Nervensysteme, die Gene und viele andere physiologische und molekulare Strukturen von uns Menschen und anderen Säugetieren so sehr ähneln, dass sich die Grundbedürfnissen von uns und anderen Tieren kaum unterscheiden. Das gilt ebenso für ihren Willen zu Leben und ihr Streben, Gefahren und Schmerzen zu vermeiden oder Freude sowie Wohlbefinden zu suchen. Wir finden bei vielen Tierarten das ganze Repertoire von Verhaltensmustern, das auch unser Leben prägt (Schmerzen, Angst, Ekel, Ärger, Hunger, Freude, Enttäuschung, Eifersucht, Trauer oder Liebe ...). Das bezieht sich keineswegs nur auf sogenannte „höherentwickelte“ Säuge- und andere Wirbeltierarten, sondern auch auf Wirbellose, wie z.B. Tintenfische. Sie und wir haben so ähnliche emotionale und kognitive Fähigkeiten, dass ein wirklicher Abstand zwischen uns und ihnen kaum noch zu erkennen ist. Diese Ähnlichkeit zwischen Tier und Mensch, insbesondere vielen Säugetieren und uns, ist auch der wesentliche Grund dafür, warum viele, die sich dessen bewusstwerden oder -sind, mit Fleischkonsum in einen moralischen Konflikt geraten.
Eine Konsequenz ist, Tiere grundsätzlich nicht mehr nur als Ressource zu betrachten. Das heißt, dass Tiere, gleich ob solche in unserer Obhut oder aber freilebende Wildtiere, nicht mehr länger nur als bloße Objekte, sondern als Subjekte mit Rechten gesehen werden müssen. Einer der ersten, der darauf pochte, war der australische Philosoph und Ethiker Peter A. D. Singer mit seinem Buch „Animal Liberation“ (1975). Der US-amerikanische
Philosoph Tom Regan ging in seinem Buch „The Case for Animal Rights“ (1983) noch weiter, dass nämlich alle Wesen, also nicht nur vernunftfähige Personen, sondern auch geistig „normal“ entwickelte Säugetiere, Vögel und sogar Fische, einen eigenen Wert besäßen. Dürfen wir dann noch die spezifische Intelligenz des Menschen als Rechtfertigung dafür nutzen, solcher Art emotionale Wildtiere, auf der Jagd zu töten? Ist der Unterschied
zwischen ihnen und uns dafür nicht viel zu marginal? Für die Jagd müssen deshalb jedenfalls wie für jedes andere menschliche Handeln ethische Kriterien gelten. Auch der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer hebt das „Wohl und Wehe“ des Menschen und anderer Tiere hervor und war damit einer der ersten in der abendländischen Philosophie, der sich gegen die perfide Behandlung und die “vermeinte Rechtlosigkeit“ von Tieren aussprach. Heute sind sich Verhaltensforscher, Tierpsychologen und Tierethiker einig in der Ansicht, dass Tiere, zumindest sogenannte höherentwickelte, ein (Selbst-) Bewusstsein haben. Das äußert sich auch in der Fähigkeit, sich in seinem Lebensraum verorten zu können, oder dem Sichern als Ausdruck von Furcht, dem Bewusstsein für Gefahr. Und dann hätten Tiere wahrscheinlich auch Antennen für ein „Weiterlebenwollen“ bzw. einen gewissen Zukunftsbezug des Lebens, so die Philosophin Ursula Wolf von der Universität Mannheim. Das erweise sich „als die einzige für alle Phänomene brauchbare Grundlage des Tötungsverbots“.
Wann immer aber in (Jagd-)Presse und Literatur von Jagdethik die Rede ist, kommen die Argumente über den Begriff der Waidgerechtigkeit, die doch den ethischen Umgang mit Wildtieren auf der Jagd zutreffend definiere, nicht hinaus. Waidgerechtigkeit beinhalte dabei als unser „jagdliches Moralgesetz“ sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen und ungeschriebenen Regeln der jagdlichen Praxis als auch die Grundelemente von Tier-, Natur- und Artenschutz. Nimmt man indessen tierethische Ansätze ernst, reicht das als Rechtfertigung für unser jagdliches Handeln nicht wirklich aus. Bestenfalls kann mit Waidgerechtigkeit die gute fachliche Praxis gemeint sein. Denn „Schwierigkeiten bereitet hier insbesondere die Frage, wie die jagdlichen ethischen Normen und die ungeschriebenen Regeln jagdlicher Praxis hergeleitet werden sollen“ wie der Umweltrechtler Maximilian Weinrich von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg zu bedenken gibt. Rein rechtlich gesehen ist „Waidgerechtigkeit“ nämlich zunächst einmal nur ein unbestimmter Rechtsbegriff, eine Art „Gleitklausel mit einer schillernden Vieldeutigkeit“, wie sein Fachkollege Till Schaller von der Universität Kassel meint. Waidgerechtes Handeln allein ist als Jagdberechtigung jedenfalls nicht ausreichend.
Daraus ergeben sich viele nach wie vor unbeantwortete Fragen. Was sind die konkreten Inhalte einer rechtlich zwar erlaubten, aber abzulehnenden Jagdpraxis, die Tieren eben doch immer wieder vermeidbare Schmerzen und auch mehr als unvermeidbare Formen von Stress und Angst zumutet, weil sie mit Hetze verbunden sind, Panik und Angst verursachen oder ein Schuss nicht genau trifft? Die rechtliche Präzisierung müsste endlich einmal die Beurteilungsmaßstäbe „deutscher Waidgerechtigkeit durch wissenschaftliche Feststellungen über tierartgemäße und verhaltensgerechte Normen ersetzen“, wie Till Schaller weiter ausführt. Denn auch das Tierschutzgesetz kommt über die hohle Formulierung nicht hinaus, die eigentlich alles, was sie regeln sollte offenlässt, nämlich die grundlegende Forderung nach dem „vernünftigen Grund“, ohne den keinem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden dürften, eine Bedingung die für das Töten von Tieren generell ebenso wie auf der Jagd gilt.
Dieser vernünftige Grund ist die gewaltigste Hürde, die bei einer ethischen Betrachtung der Jagd überwunden werden muss (und worum sich deshalb auch die meisten, die meinen, sich mit Jagdethik zu befassen, drücken). „Will man die Jagd rechtfertigen, müsste man besondere Gründe anführen können, die hier eine Ausnahme von der Rücksicht auf Tiere in ihrer Leidensfähigkeit legitimieren“ wie die beiden Tierethiker Ursula Wolf und ihr Kollege Jens Tuider meinen. Was könnten solche Gründe sein? Sie müssten für einen bestimmten Zweck in unserem Leben unerlässlich sein, d.h., es darf kein alternatives Mittel mit demselben Nutzen geben. Und es geht bei der Definition des vernünftigen Grundes um die Tiere als Individuen und nicht um eine Jagd aus Gründen des Schutzes von Lebensräumen oder Wildarten, wie oftmals von Jägerseite argumentiert wird. Das gilt auch für die einheimischen „Raubwildarten“ und außerdem die Neozoen, die alle genauso empfindungsfähige Wesen sind wie ihre Beutetiere. Warum sollte ihr Lebensrecht geringer wiegen als das schützenswerter Niederwildarten?
Aus ethischer Sicht und überhaupt kann sich deshalb niemand, Jagende wie Nichtjagende, dem das Wohl von Tieren ganz allgemein und unserer jagdbaren Wildarten im Besondern am Herzen liegt, so ohne weiteres für die Jagd aussprechen. Jedenfalls habe ich keine Argumente finden können, die dem im deutschen und österreichischen Tierschutzgesetz enthaltenen „vernünftigen Grund“ für die Tötung von (Wild-)Tieren auch nur
ansatzweise gerecht würden (im schweizerischen Tierschutzgesetz heißt es adäquat „Niemand darf ungerechtfertigt einem Tier ...“). Anscheinend lässt sich die Frage des Tötens von Tieren einfach nicht befriedigend beantworten. Allenfalls wären gewisse „Notfallsituationen“ denkbar, für die es keine praktikablen Alternativen zum Töten von Wildtieren gibt. So „können wir uns vorstellen, dass man ein Tier absichtlich tötet [...], weil es eine erhebliche Gefahr für Menschen darstellt: Notwehr (wenn ein Mensch von einem Wildtier ernsthaft angegriffen wird), Notstand (wenn wir versehentlich ein Wildtier schwer verletzt haben) oder das Wohl eines Tieres (wenn sein Leben keine Chance mehr auf überwiegend positive Er-
lebnisse hat)“ wie die beiden Tierethiker Herwig Grimm aus Wien und Markus Wild aus Basel zu bedenken geben. Dann wäre die Erlegung eines Stückes Wild die „Ultima Ratio“.
Und die Moral von der Geschicht‘ – etwa keine Jagd auf Wildtiere? Aus tierethischer Sicht bewegt sich die Jagd jedenfalls auf schmalem Grat. Denn einen „vernünftigen Grund“ dafür formulieren zu können, ist, wie zuvor begründet, schwierig. Da lässt sich die Jagd heute und in unserer Gesellschaft mit notwendiger Nahrungsbeschaffung oder Notwehr nicht mehr rechtfertigen. Demgegenüber hat das Argument, Jagd auf Wildtiere, die ihr
Leben zuvor selbstbestimmt in freier Natur verbringen konnten, sei gegenüber dem barbarischen Tod im Schlachthof eine vergleichsweise humane Tötungsart, doch einiges Gewicht. Auch wenn man ein moralisches Übel nicht durch den Verweis auf ein noch größeres anderes rechtfertigen kann, wie Wolf und Tuider argumentieren, fragt andererseits auch Martha Nussbaum, die einflussreichste US-amerikanische Philosophin der Gegenwart,
„ist ein solcher Tod ein Übel für das Tier, und ist es ethisch zulässig, dass wir ihn herbeiführen?“ Sie stellt damit wohl eine für die Entscheidung Pro oder Contra Jagd sehr bedeutsame Frage.
Und Pro-Argumente? Da fällt mir als Biologe ganz spontan unsere evolutionär geprägte ursprüngliche Natur als Jäger und Sammler ein, eines Allesfressers, zu dem auch das Bedürfnis nach gelegentlichem Fleischkonsum gehört, Jägerinnen und Jäger als Teil einer „naturhistorischen“ Räuber-Beute-Beziehung? So gilt es heute unter Evolutionsforschern als ausgemacht, dass die 11.000 Jahre seit der sogenannten Neolithischen Revolution, in der wir allmählich vom Jäger und Sammler zum Getreide-, Viehzüchter und Städter wurden, eine viel zu kurze Zeitspanne waren, um die zuvor in fast zwei Millionen Jahren unserer Entwicklungsgeschichte evolvierte und genetisch fixierte biologische Jagdambition aus unserem Verhaltensrepertoire zu löschen. Warum also sollten nicht einige von uns dieses Erbe, zumindest in Maßen, immer noch „im Blut haben“ und leben dürfen, indem sie auf die Jagd gehen um Beute zu machen? Der deutsche Jagdphilosoph Bernd Balke nennt das „die einzige ethisch obligate Ur-Legitimation der Jagd“, Nutzung als ein Grundprinzip der Natur: „fressen und gefressen werden“, was nichts anderes bedeutet, als dass kein Leben möglich ist und es keine Evolution gegeben hätte, ohne das Sterben anderer. Und auch jene, die in der Jagd eine Form der Bodennutzung, vergleichbar der Feld- und Waldwirtschaft, sehen, führen damit ein durchaus ernst zu nehmendes Motiv fürs Jagen an. Dass auch das bedeutet, dafür Lebewesen töten zu müssen, könnte genauso dem Land- oder Forstwirt vorgeworfen werden. Das Getreide des Ackers oder die Bäume im Wald sind ja schließlich ebenso Lebewesen.
Jedenfalls verlangt alles jagdliche Tun eine hohe Selbstdisziplin, die längst nicht alle Jägerinnen und Jäger haben. Jeder oder Jede sollte sich über den Schuss, den er oder sie abgeben, Rechenschaft ablegen. „Die einzige moralische Instanz wirst du selbst sein“, wie der erfahrene Bergjäger Jean-Pierre Vollrath aus Oberammergau zu bedenken gibt. Die Jägerschaft sollte durch störungsarme Jagdmethoden darauf hinarbeiten, aus der
„Landschaft der Angst“, die Jäger verursachen, eher eine „Landschaft des Miteinanders“ zu entwickeln, in der Wildtiere „uns andere Tiere“ nicht mehr nur als Feinde erleben - dass wir vom Herrscher zum Partner werden, wie es Herwig Grimm formuliert!
Dr. Bertram Georgii: Wildbiologe, ExJäger und Autor der Bücher „Rothirsch wohin? – Gegenwart und Zukunft einer faszinierenden Wildart“ (Müller Rüschlikon Verlag 2022) und „Jagd heute – Wild und Jagd neu denken“ (NVM Verlag Grevesmühlen, im Druck)