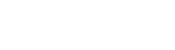Von Christoph Boll
Von der Antike bis zur Urbanisierung, von der höfischen Angelegenheit zu aktuellen gesellschaftlichen Konflikten: Jagd und Jäger, Wild und Wald im Spiegel der Literatur im jeweiligen Zeitgeist und der Wirklichkeit. Eine Serie für „natur+mensch“.

Wer Jagd vermitteln will, muss rational, reflektiert sprechen. Daraus resultiert die Aufgabe, tief empfundene Emotionen zum Wort zu verhelfen, sie also aus der Irrationalität zu lösen, zu erklären und dadurch nachvollziehbar zu machen. Das aber ist bis heute für viele Jäger schwer. Sie kennen das von Novalis formulierte empathische Empfinden, ein tiefes Gefühl, das weit über das nüchtern Handwerkliche hinausgeht und eben nicht nur rein verstandesmäßig erklär- und vermittelbar ist. Außenstehende können das kaum nachvollziehen. Dazu müssen sie nicht einmal Jagdgegner sein. Nicht nur in deren Kreisen wird gefordert, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu novellieren, weil das Waidwerk sich veränderten gesellschaftlichen Bedingungen anpassen müsse. Sie reduzieren Jagd auf eine reine Dienstleistung in einer urban geprägten Umwelt.
Deshalb scheint heute nur noch die Gefährdung der Umwelt als schriftstellerisches Natur-Motiv vermittelbar. Nach dem Sündenfall hat der Mensch den Garten Eden verloren. Wer diese Entfremdung überwindet, kann doch nur ein komischer Kauz sein, einer, der nicht in die Zeit passt. Diese Erfahrung musste Ludwig Ganghofer (1855-1920) machen. Er war neben seinem Zeitgenossen Ludwig Thoma die zweite Koryphäe der bayrischen Literaturgeschichte und fand zu seiner Zeit ein breites Lesepublikum. Kitsch seien seine Heimatromane, warfen ihm die Kritiker vor, so wie spätestens seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts das mannigfach kopierte Gemälde des röhrenden Hirsches nur noch als Kitsch wahrgenommen wird. Gleiches gilt für die in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Kino boomenden Heimat-, Jagd- und Försterfilmen, die meist Literaturadaptionen sind.
„Er war kein Jäger, mein Freund, aber was sich ihm so ab und zu von all dem schönen Leben zwischen Wald und Felsen erzählte, machte ihn lüstern, und da war es einer seiner Lieblingswünsche, einmal einen Hirsch ‚schreien‘ zu hören.“ So leitet Ganghofer seine kurze Erzählung „Hirschbrunft“ ein. Selbst für den Jäger ist das Leben im Revier nur noch ein Ausflug. Denn nach erfolgreicher Jagd muss auch er das Terrain wieder verlassen, „um der Stadt entgegenzureisen“. Das Waidwerk ist zum Hobby, zu Freizeitbeschäftigung und Flucht vor dem „eigentlichen Leben“ geworden.
Jagd als beliebige Kulisse in Kriminalromanen
In diesem eigentlichen Leben funktionieren Jagd und Natur noch als beliebige Kulisse für Kriminalromane – häufig Regionalkrimis wie Jacques Berndorfs 1998 erschienene „Eifel-Jagd“. Für die Mehrheitsgesellschaft hat sie oft einen exotischen Charakter. Oder Jagd dient der Persiflage sowie als Motiv für Sozialkritik an reichen, moralisch zweifelhaften Männern, die gemeinsam beim Waidwerken Ränke schmieden und Geschäfte machen. Es werden Klischees bedient. Diese Entfremdung hat auch die ländlichen Regionen erreicht, die längst von Stadtmenschen bewohnt sind. Wer das Töten von Tieren ablehnt, dem erscheint Jagd obszön und der beschimpft Jäger als Mörder. Nicht nur zur Reiz-, sondern sogar zur senilen Witzfigur ist der Jäger in der filmischen Satire „Halali oder Der Schuss ins Brötchen“ verkommen. Da stehen sich zwei Parallelgesellschaften gegenüber, die nichts mehr gemein haben.
Moderne Jagdliteratur abseits der breiten Öffentlichkeit
Häufig mischen sich Sozialkritik und tierethische Diskussionen. Selbst Jäger erliegen diesem Trend. Frühes Beispiel für diese Entwicklung ist Ernst Jüngers 1952 veröffentlichte Kurzgeschichte „Die Eberjagd“. Ganz im Sinne der heutigen Jagdgegner wandelt sich darin die jugendliche Hauptfigur Richard vom Saulus zum Paulus. Der 16-Jährige steht während einer Drückjagd ohne Büchse neben seinem Kameraden auf einer Lichtung. Er ist enttäuscht, denn er darf noch keine Waffe führen. Sein Kamerad hingegen erlegt einen Keiler. Während die Jagdgesellschaft ihm zur Erlegung gratuliert, heißt es von Richard: „Das grobe Geschrei bedrückte ihn. Und wieder schien ihm, dass ihnen der Eber hoch überlegen war.“ Am Ende schläft Richard erstmals ein, „ohne an das Gewehr gedacht zu haben. Dafür trat nun der Eber in seinen Traum.“ Da wandelt sich jemand zu einem Heiligen Hubertus, der noch gar nicht gejagt hat.
Neben Erlebnisberichten als eng begrenzte Spartenliteratur gibt es fiktionale Jagdliteratur seither allenfalls noch in esoterischen Nischen, nicht aber als Bestandteil des anerkannten Kulturbetriebs. Der amerikanische Literaturwissenschaftlicher Prof. Dr. John A. McCarthy kommt zu dem Fazit: „Zwar haben Heinrich Schneider mit seinem Bestseller ‚Der Forstaufseher Moosbichler‘ (1960) Goede Gendrich (eigentlich Ludwig Dörbandt) mit etlichen Werken, darunter ‚Mit den Augen eines Jägers. Erlebtes und Erlauschtes‘ (1992), und die Initiative schreibender Jäger mit dem schönen Sammelband ‚Mit grüner Feder. Jäger von heute erzählen‘ (1998) an alte Traditionen angeknüpft. Und immerhin erhält man Anregungen durch den Dichterkreis Jagdlyrik im BJV, der 2011 ins Leben gerufen worden ist. Alle solche Unternehmen sich beachtenswert. Doch finden sie weder in der breiten Öffentlichkeit noch in der Literaturwissenschaft Resonanz.“
Quelle: „natur+mensch“