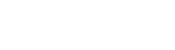Von Rainer Schmidt-Arkebek
„Der Pirschjäger“, ein Selbstporträt.
Die Krone der Jagd, die Pirsch mit der Büchse auf das Schalenwild, war meine Passion. In der Stand-Pirsch versucht der Jäger nahezu unsichtbar zu sein, um von dem Wild nicht wahrgenommen zu werden. Die uns evolutiv verbliebenen rudimentären Sinne, wie das Sehen, Hören, Riechen und Tasten werden beansprucht. Der Jäger muss versuchen, sich des instinktiven Verhaltens des immer gejagten Wildes anzupassen, sich vorzustellen, wie sich das Wild verhalten könnte bzw. würde.
Der von mir bereits vielfach zitierte spanische Philosoph J. Ortega y Gasset schreibt in seinem Buch „Meditationen über die Jagd“:
 „Aber all dies geschieht, weil der Jäger, während er sich vorpirscht oder zusammenkauert wartet, sich unterirdisch mit dem Tier verbunden fühlt, ob dies nun in Sicht oder verborgen oder abwesend ist. Wer nicht Jäger ist und dies liest, wird diese letzten Worte vielleicht für reine Phrase und blasse Redensart halte. Aber nicht so die Jäger. Sie wissen recht gut, dass sie buchstäblich wahr sind: sobald man sich im Feld befindet, ist das erste und gleichsam die Achse der ganzen Situation: Diese mystische Verbundenheit mit dem Tier; man spürt es und ahnt es, und lässt uns die Umgebung automatisch vom Blickpunkt des Wildes aus wahrnehmen, ohne dass wir unsern eigenen aufgeben. Die Sache ist an und für sich paradox und scheint sich selbst zu widersprechen, sie lässt sich aber nicht leugnen. Letzten Endes handelt es sich um eine überaus einfache Angelegenheit:
„Aber all dies geschieht, weil der Jäger, während er sich vorpirscht oder zusammenkauert wartet, sich unterirdisch mit dem Tier verbunden fühlt, ob dies nun in Sicht oder verborgen oder abwesend ist. Wer nicht Jäger ist und dies liest, wird diese letzten Worte vielleicht für reine Phrase und blasse Redensart halte. Aber nicht so die Jäger. Sie wissen recht gut, dass sie buchstäblich wahr sind: sobald man sich im Feld befindet, ist das erste und gleichsam die Achse der ganzen Situation: Diese mystische Verbundenheit mit dem Tier; man spürt es und ahnt es, und lässt uns die Umgebung automatisch vom Blickpunkt des Wildes aus wahrnehmen, ohne dass wir unsern eigenen aufgeben. Die Sache ist an und für sich paradox und scheint sich selbst zu widersprechen, sie lässt sich aber nicht leugnen. Letzten Endes handelt es sich um eine überaus einfache Angelegenheit:
Der Verfolger kann nicht verfolgen, wenn er nicht sein Schauen mit dem Verfolgten vereinigt.
Das heißt, die Jagd ist eine Nachahmung des Tieres. Wer sie als ein menschliches Faktum auffasst und nicht als ein zoologisches Faktum, das der Mensch wieder zum Vorschein bringen will, versteht nicht was die Jagd ist. In dieser mystischen Einheit mit dem Wild entwickelt sich unmittelbar eine Ansteckung, und der Jäger beginnt, sich wie jenes zu verhalten. Er wird sich instinktiv ducken, um nicht gesehen zu werden; er wird beim Gehen jedes Geräusch vermeiden; er wird die ganze Umgebung vom Blickpunkt des Tieres aus betrachten und mit der Aufmerksamkeit, die diesem Eigen ist. Das nenne ich drinnen im Felde sein“.
Man jagt nicht nur um der Jagd willen, sondern um Beute als Nahrung zu erwerben. Der urban lebende Mensch hat seinen Lebensstil mehr und mehr von einem naturnahen Leben entfernt und das Verständnis, Tiere zu töten zu müssen, um Fleisch verzehren zu können, ist ihm abhanden gekommen. Dabei vergisst oder verdrängt er, dass die Tiere, von denen die Bratwurst oder das Steak für seinen maßlosen Fleischkonsum stammen, millionenfach, das heißt massenhaft getötet werden und in der Massentierhaltung gemästet wurden. Das Tierwohl kommt da meist nicht vor und hat auch keinen Platz.
Wenn ich erfolgreich jagen konnte, das heißt Beute machte, konnte ich mich durchaus auch über eine Trophäe freuen, das will ich gerne eingestehen. Viel wichtiger war mir allerdings, meiner Familie, der Sippe, frisches, gesundes und wohlschmeckendes Wildbret nach Hause zu bringen. Ein ähnliches Glücksgefühl wird der Jäger der Steinzeit nach erfolgreicher Jagd, die für ihn essenziell war, empfunden haben.
Hier sei noch einmal J. Ortega y Gasset zitiert:
„Die Jagd ist wie jede menschliche Tätigkeit in ihre Ethik eingebaut, die Tugenden von Lastern unterscheidet. Es gibt den gemeinen Jäger, aber es gibt auch eine Verhimmelung auf Seiten des Jägers. All dies bezieht sich auf die letzte Szene, die den Abschluss der Jagd bildet und in der das herrliche Fell des Tieres mit Blut befleckt und jener Körper, der reine Beweglichkeit war, in die absolute Paralyse des Todes verwandelt wird. Ist es erlaubt so etwas zu tun? fragen wir uns“.
Und weiter formuliert J. Ortega y Gasset:
„Zum guten Jäger gehört eine Unruhe im Gewissen angesichts des Todes, den er dem bezaubernden Tier bringt. Er hat keine letzte und gefestigte Sicherheit, dass sein Verhalten richtig ist. Aber, man verstehe dies richtig, er ist auch des Gegenteils nicht sicher“.