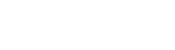Von Rainer Schmidt-Arkebek
Von Jägern und Gejagten
J. Ortega y Gasset schreibt in seinen „Meditationen über die Jagd“
„Die Katze jagt Mäuse. Der Löwe jagt Antilopen. Der Sphex und andere Wespen jagen Raupen und Kornwürmer. Die Spinne jagt Fliegen. Der Haifisch kleinere Fische. Der Raubvogel jagt Kaninchen und Tauben. Die Jagd erstreckt sich also fast über das gesamte Tierreich. Es gibt kaum eine Klasse oder Phyle, in der nicht Gruppen von jagenden Tieren auftauchen. Es ist also nicht einmal eine Eigentümlichkeit der Säugetiere“.
 Etwas später formuliert J. Ortega y Gasset:
Etwas später formuliert J. Ortega y Gasset:
„Man vergesse nicht, dass wir jetzt nicht nur von der sportlichen Jagd sprechen, sondern von jeglicher Jagd, sowohl der menschlichen wie auch der außermenschlichen. Damit nun wirklich dieses bestimmte Ereignis zustande kommt, das wir Jagd nennen, muss das begehrte Tier seine Chance haben, muss es grundsätzlich auch entwischen können; das heißt, es muss über Mittel von einiger Wirksamkeit verfügen, um der Verfolgung zu entgehen, denn die Jagd ist genau betrachtet die Reihe von Bemühungen und Geschicklichkeiten, die der Jäger aufwenden muss, um mit ausreichender Häufigkeit über die Gegenwirkungen des gejagten Tieres Herr zu werden. Wenn es diese nicht gäbe, wenn die Unterlegenheit des Tieres absolut wäre, so hätten die jagdlichen Fähigkeiten keine Gelegenheit, sich zu entwickeln oder, was dasselbe ist, das eigentümliche Faktum der Jagd existierte überhaupt nicht. Wenn ich dem jagenden Tier das gejagte gegenüber stelle, so meine ich das begehrte und verfolgte, dass sehr wohl auch nicht erreicht werden kann.
Es ist für die Jagd nicht wesentlich, dass sie erfolgreich ist. Im Gegenteil, wenn die Anstrengungen des Jägers immer unfehlbar von Erfolg gekrönt wäre, dann wäre es keine jagdliche Anstrengung, sondern etwas anderes. Der Möglichkeit oder Chance auf Seiten des Wilds, dem Jäger zu entkommen, entspricht auf Seiten des Jagenden die Möglichkeit, ohne Beute heimzukommen“.