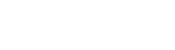Von Gert G. von Harling
Meine Gebirgsschweißhündin Diva machte ihrem Namen alle Ehre. Waren andere Hunde in der Nähe, ging es um Toben und Schmusen, benahm sie sich wie die sprichwörtliche Primadonna. Die Allüren waren allerdings vergessen, sobald ich den Schweißriemen in der Hand hatte. Dann überwog die Jagdpassion der Hündin. Ob Rot- oder Schwarz-, Reh- oder Raubwild, selbst auf der kranken Hasenspur arbeitete sie zuverlässig und hat sogar Suchen von geflügelten Fasanen und Gänsen erfolgreich beendet. Dass meine Hündin sich erst ab einem Kronenzwölfer bitten lassen würde, wie ein Freund behauptet, grenzt also an üble Nachrede.
„Is nur ein Frischling, er liegt hundertprozentig, ne ganz einfache Suche für einen Hund wie ihren“, beruhigte mich der Schütze, als wir zum Anschuss stapften. Es folgte das übliche Zeremoniell, um den Hund auf seine Arbeit einzustimmen: Abgelegt beobachtete er, wie ich auf den Knien am Erdboden herumrutschte und nach Pirschzeichen forschte. Auf der leichten Schneedecke waren Schalenabdrücke einer Sau zu erkennen, aber nichts, was auf einen Schuss hindeutete - Schnittborsten, Schweiß oder gar Knochensplitter-Fehlanzeige. Kurzer Augenkontakt, und schon kam Diva zu mir geschlichen, ließ sich abliebeln und zog am langen Riemen mit tiefer Nase in den geläuterten Kiefernbestand.
Nach dreißig Metern verwies sie helle Schweißtropfen, für mich kaum auszumachen, für die Hundenase kein Problem.
Es war nicht schwierig der Wundfährte zu folgen. Ab und an warfen tiefhängende Zweige Schnee ab, wenn wir sie streiften, aber kaum ein umgestürzter Baum oder heruntergefallener Ast behinderte unser zügiges Weiterkommen. Zwei, dreimal knackte ein abgestorbener Aststummel, den ich versehentlich mit der Schulter abbrach, andere Geräusche wurden vom Schnee verschluckt. Eine einfache Nachsuche, freute ich mich.
Wie oft mussten wir uns schon durch bürstendichte Bestände, sichere Rückzugsgebiete für das leidende Wild, quälen, wie oft habe ich geflucht, wenn mich die Hündin durch eine wahre Urwaldwildnis zerrte, in die ich nur auf allen Vieren folgen konnte, in der sich der Riemen verfing, die Büchse auf dem Rücken ein Weiterkommen erschwerte, der Hut vom Kopf gerissen wurde oder sich spitzes Gezweig in die Kleidung bohrte und ein Vorwärtskommen fast unmöglich machte.
Eine“ totsichere“ Suche?
Diese Nachsuche, so glaubte ich, führt zu einem schnellen Ende. Die Sau hatte über drei Stunden Zeit, um krank zu werden, war wahrscheinlich längst verendet, überlegte ich, und in dem „aufgeräumten“ Kiefernwald glich das Folgen hinter dem roten Hund einem Spaziergang.
In dem knöchelhohen Beerkraut waren keine Fährten mehr zu erkennen. Auf den nächsten dreißig, vierzig Metern verwies meine vierläufige Helferin noch einmal Lungenschweiß, dann wurden die Pirschzeichen weniger, schließlich gab es keine Bestätigung mehr, dass wir der Wundfährte folgten. Doch der Hund arbeitete ruhig, war sich sicher, und ich war gewiss, gleich würde der Riemen schlaff, obwohl außer der konzentrierten Arbeit von Diva nichts dafür sprach, dass wir auf der richtigen Fährte waren.
Nach weiteren dreihundert Metern Riemenarbeit durch lichtes Altholz, zog die Hündin schnurgerade auf eine umgestürzte Fichte zu. Noch trennten uns fünf, sechs Meter von der zugeschneiten, dichten Krone, als auf der anderen Seite eine Sau, lediglich als dunkler Klumpen auszumachen, im aufstiebenden Schnee davon prasselte und längst verschwunden war, als ich die Büchse von der Schulter gerissen hatte. Diva heulte auf, blickt zu mir, zerrte am Riemen, und ich konnte sie gar nicht schnell genug von ihrer Halsung befreien. Dann hörte ich kurz „jiff!, jiff!, jiff!“, aber lange, bange Minuten blieben aus. Kaum hatte ich mich aufgerichtet, folgte dem hellen Hetzlaut dunkler, melodischer Standlaut, wütendes, aggressives Aufjaulen und dann wieder die regelmäßige Musik, mit der der Hund seinen Herrn ruft.
Eine einfache Nachsuche?
Der Wind stand günstig. Ich konnte direkt auf den Ball zuschleichen und dem Hund zu Hilfe eilen.
Zweihundert Meter versuchte ich noch, ohne Rücksicht auf brechendes Gezweig oder laute Tritte zu nehmen, im Eilschritt zu laufen, je näher ich aber kam, desto behutsamer bewegte ich mich vorwärts. Als mich noch knapp hundert Meter von dem Kampfplatz trennten, schlich ich schließlich geduckt und besonders vorsichtig weiter.
Kurze Pause, aufrichten, recken, damit sich schmerzende Muskeln und Sehnen entspannen, dann ging es in eine jüngere Kiefernschonung, in der ich maximal zwanzig Meter weit sehen konnte. Der Wind stand noch zu unseren Gunsten. Schnee stäubte ins Gesicht, behinderte meine Sicht zusätzlich und rieselte mir ins Genick, wenn ich mich unter einem tiefhängenden Ast hindurchzwängen musste. Zweige peitschten unangenehm auf meine bloßen Hände und Wangen. Da erschien die Hündin in der Kulturreihe vor mir. Sie hatte mich nicht wahrgenommen, war sofort wieder aus meinem Blickfeld verschwunden. Langsam kroch ich weiter.
Und dann erblickte ich zehn Gänge vor mir die angeschossene Sau. Der Hund sprang in respektvollem Abstand um sie herum und bellte sich fast die Lunge aus dem Hals, während der Überläufer einige müde Ausfälle gegen seinen Widersacher machte. Diva wich jedes Mal geschickt aus, bemerkte mich, näherte sich augenblicklich voller Passion der Sau erneut, und wie so oft war ich wieder von ihrem Urvertrauen beeindruckt: Hilfe naht, der Alte ist da, jetzt wird alles gut, jetzt kann nichts mehr schief gehen, schien die Hündin aus den vielen gemeinsamen vorangegangenen Nachsuchen gelernt zu haben.
Eine“ totsichere“ Suche?
In drei, vier Metern Abstand umkreiste sie die kranke Sau, war in ständiger Bewegung. Die Reaktionen, Wendungen, Ausfälle des Überläufers wirkten lethargisch, während die Hündin unermüdlich verbellt e immer unbändiger wurde. Ihr giftiger Laut verstummte erst nach dem Knall des Fangschusses.
Vor uns lag eine wohl fünfzig Kilogramm schwere Überläuferbache.
Während Diva sich den Schnee aus dem Fell schüttelt und zögerlich den blasigen Lungenschweiß auf der Schwarte am Ausschuss bewindete, wunderte ich mich über die unbefriedigende Wirkung des Geschosses.