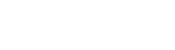Von Dr. Thomas Gehle, Jagdwissenschaftler
Zeitgemäße Jagdethik:
Herbstzeit ist Jagdzeit. Gehen wir mit dem Wild richtig um? Dr. Thomas Gehle stellt eine jagdkundliche Analyse zur Mensch-Tier-Beziehung vor.
„Dies ist des Jägers Ehrenschild, daß er beschützt und hegt sein Wild. Waidmännisch jagd, wie’s sich gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt.“ Wer kennt nicht die erste Strophe der Jägerlyrik von Oskar von Riesenthal aus dem Jahr 1880. Waidmännisch Jagen heißt, sein Handwerk zu beherrschen. Aber wie sieht das aus? Im Zentrum der Waidgerechtigkeit steht eine unbestimmte, ethische Einstellung des Jägers zu seinen Mitmenschen und zum Tier. Der waidgerechte Jäger weiß, was er zu tun oder zu lassen hat. Aber welche ethische Einstellung, welche Beziehung haben wir Jäger denn zum Wild? Gibt es überhaupt eine typische Einstellung dazu?
Christliche Tierethik
Riesenthals Reime zeugen von einer spezifisch christlichen Tierethik. Wir sehen hier das Wild aus Sicht der Bibel, als Mitgeschöpf. Doch bleiben biblische Texte ohne unmittelbare ethische Relevanz, wie Norbert Hoerster aufgezeigt hat. Als Professor für Rechts- und Sozialphilosophie an der Universität Mainz ließ sich Hoerster 1998 vorzeitig in den Ruhestand versetzen. Denn seine Haltung zur Abtreibung ist umstritten. So sprach er sich 1996 dafür aus, das Lebensrecht eines Menschen solle erst mit der Geburt beginnen, da bei dem Ungeborenen kein Ichbewusstsein und damit auch kein Lebensinteresse gegeben sei. In seinem 2004 erschienenen Buch „Haben Tiere eine Würde“ vertritt er die Auffassung, dass sich aus der biblischen Schöpfungsgeschichte keinerlei moralische Forderungen für den Umgang des Menschen mit Tieren ableiten lassen. Hoerster geht davon aus, dass die Bibel wohl in erster Linie die Bedeutung des Tieres für die eigene Ernährung in den Vordergrund stellt und zitiert Auszüge wie „Der Gerechte weiß, was sein Vieh braucht“ (Sprüche 12, 10) oder „Hast Du Vieh, so schau darauf; ist es brauchbar, so behalt es“ (Sirach 7, 22). Danach ließe sich aus der Bibel allenfalls eine gewisse Rücksichtnahme gegenüber Tieren ableiten. Die Tatsache, dass viele Menschen an Gott und die Bibel glauben, ist für Hoerster kein hinreichender Beleg für die Wahrheit von Glaubensinhalten. Es gibt ja auch Atheisten. Wie sollen die sich denn gegenüber Tieren verhalten?
Jagdliches Brauchtum
Das jagdliche Brauchtum ist Ausdruck einer „Ehrfurcht vor dem Leben“ und es könnte sogar aus diesem Mensch-Tier-Verständnis abgeleitet werden, man solle Tiere genauso behandeln wie Menschen. Logisch gedacht, setzt eine Tierethik, die Tiere uns Menschen gleichstellt, voraus, dass es zwischen Menschen und Tieren vor allem im moralischen Sinne keine Unterschiede gibt. Aber können denn Tiere denken und handeln wie Menschen? Sind Tiere moralische Wesen? Dürfen wir Jäger darüber entscheiden, welches Tier lebt und welches stirbt, und vor allem, wie es stirbt? Für den Ethiker Hoerster jedenfalls gibt es zu der Devise, Menschen wie Menschen und Mäuse wie Mäuse zu behandeln, keine vernünftige Alternative.
Menschlicher Altruismus
Wenn wir Jäger uns um „unser“ Wild kümmern, es hegen, nachsehen, ob es ihm gut geht, ob es bejagbar ist, wenn wir uns den Kopf darüber zerbrechen, warum wir so wenig Hasen sehen, wie verhalten wir uns da eigentlich? Wenn wir von unserem Jagdhund erwarten, dass er uns den Erpel aus dem Wasser zieht, wenn wir uns um ihn sorgen, weil sein Fell nicht glänzt, wie verhalten wir uns da eigentlich?
Welche Interessen verfolgen wir, unsere eigenen oder die des Hasen oder die unseres Hundes? Verfolgen wir da nicht aus eigenem Antrieb die Interessen „unserer“ Tiere wie unsere eigenen Interessen? Wer so handelt, verhält sich altruistisch. Der Begriff Altruismus leitet sich aus dem Lateinischen „alter“ – „der andere“, ab und wird entweder als das Gegenteil oder als eine Unterform des Egoismus verstanden. Egoistisch handelt, wer danach trachtet, eigene Zwecke vor anderen, gemeinsamen Zwecken zu verfolgen. Verhalten wir Jäger uns also altruistisch gegenüber Tieren? Hoerster vertritt diese Ansicht.
1964 veröffentlichte der Evolutionsbiologe William D. Hamilton einen Text über „Die genetische Evolution des sozialen Verhaltens“. Hamilton erweiterte das Konzept Darwins, indem er erklärt, dass vor allem der Grad der Verwandtschaft altruistisches Verhalten begründet. Ein Individuum erhöht die Überlebenschancen seiner Gene nicht nur durch die eigene Vermehrung, sondern auch dadurch, dass es sich darum kümmert, dass seine eigenen Verwandten ihre Zahl der Nachkommen steigern. Dazu ein Beispiel: Biologen stellten fest, dass kinderlose Erdhörnchen eine Gruppe vor Feinden nur dann warnen, wenn der Gruppe Geschwister, Onkel und Tanten angehören. Sind nicht Verwandte, sondern andere Hörnchen in Gefahr, bleiben sie stumm.
„Wer zum Beispiel einen Vogel in einem Nest tötet und dadurch zwei andere Vögel in dem Nest vor dem Tod bewahrt, vermehrt dadurch den Lebenswert von Vögeln und handelt durchaus altruistisch“, schreibt Hoerster. Er sieht „durch die menschliche Gewohnheit des Fleischverzehrs von Tieren“ eine Vergrößerung des Gesamtwertes tierischen Lebens. Er lehnt es aber ab, so wörtlich „bloß um meine Treffsicherheit mit einem Jagdgewehr zu testen“, auf Tiere zu schießen.
Tierisches Bewußtsein
Hoerster nimmt aufgrund des aktuellen Wissens an, dass selbst unsere nah verwandten Menschenaffen wie Schimpansen, Orang-Utans oder Gorillas kein oder maximal nur ein gewisses Überlebensinteresse haben. Wie Hoerster darlegt, haben Tiere ohne Ichbewusstsein keine zukunftsbezogenen Wünsche. Sie haben, so Hoerster, „nicht die Fähigkeit, sich selbst als im Zeitablauf identische Individuen mit eigener Vergangenheit und Zukunft zu erfahren“. Aus den Erkenntnissen der Verhaltensforschung, dass Tiere zwar durch vergangene Erlebnisse und durch zukunftsgerichtete Instinkte in ihrem Verhalten bestimmt werden, darf nach Hoerster aber nicht automatisch geschlossen werden, dass dieses Lebewesen sich vergangene oder künftige Erlebnisse auch als eigene Erlebnisse vergegenwärtigt.
Hat der Sozialphilosoph Hoerster also Recht, wenn er davon ausgeht, Tiere hätten kein Bewusstsein? Der Psychologe und Neurowissenschaftler Marc D. Hauser, bis 2011 hoch dekorierter Hochschullehrer an der Harvard University, die ihm damals jedoch vorwarf, sich in mindestens acht Fällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens schuldig gemacht zu haben, schreibt dazu in seinem Buch „Wilde Intelligenz - Was Tiere wirklich denken“ aus dem Jahr 2000 eine Art Wunschliste an die künftige Forschung, die für ihn aus sechs miteinander verflochtenen Problemen besteht:
Forschungsbedarf
Wenn Tiere moralische Wesen wären, dann sollten sie erstens moralischen Empfindungen einen Wert zuordnen. Um moralische Empfindungen zu haben, muss man über ein Selbst-Bewusstsein verfügen. Tiere können zwar einen Sinn für ihren eigenen Körper entwickeln. Sie können aber anderen Tieren keinen bestimmten mentalen Zustand zuordnen. Für Hauser ist die Gleichheit von Empfindungen wie Schuld oder Scham unter uns Menschen über alle Kulturen hinweg gerade der Unterschied, nicht ein Tier, sondern eben ein Mensch zu sein. Und wir Menschen messen diesen Empfindungen auch noch einen Wert zu. Der waidgerechte Jäger hat Mitleid mit dem kranken Stück und erlöst es von seinen Leiden, er tut also Gutes und macht das Richtige.
Tiere sollten zweitens über wirksame Mechanismen verfügen, die es ihnen ermöglichen, ihre Triebe zu kontrollieren und ihre Erwartungen zu verändern.
Drittens müssten Tiere die Überzeugungen, Wünsche und Bedürfnisse anderer im Auge haben. Es fehlen selbst für Menschenaffen Hinweise darauf, dass Tiere Zugang zu ihren eigenen Vorstellungen haben, diese bewerten und darüber nachdenken. Zwar können sich Tiere erbittert verprügeln und danach wieder vertragen, sie können aber nicht einschätzen, ob eine Gegenleistung fair ist oder ob es falsch ist, den Nachbarn zu töten.
Viertens sollten Tiere ein Verständnis dafür haben, wie sich ihre Handlungen auf die Gefühle und Gedanken anderer Artgenossen auswirken. Tier sind aber „Geschöpfe des Jetzt“, so Hauser. Tieren ist nicht bewusst, inwieweit beispielsweise ein Angriff auf ein Muttertier oder auf einen Konkurrenten gefährlich ist oder dass der Angriff mit dem eigenen Tod enden könnte und was genau dies bedeuten würde.
Fünftens haben moralische Wesen wie wir Menschen einen Begriff von Dingen wie Pflicht und Verantwortung und benutzen diese Richtschnur beim Umgang mit anderen. Es ist bislang unbekannt, was Tiere von ihrer Beziehung zu anderen halten. Der Schwarzwildfachmann Heinz Meynhardt fand heraus, dass tote Rottenmitglieder verschmäht, rottenfremde Sauen aber ohne weiteres aufgefressen werden.
Und schließlich sollten Tiere Normen von Handlungen und Gefühlen innerhalb ihrer Gesellschaft nachvollziehen können. Sie sollten sich wehren, wenn ihre Rechte verletzt werden. Empfindet denn ein dominanter Wolf Wut, wenn ein rangniederer Rüde ihm vor der Nase ein empfängnisbereites Weibchen wegschnappt? Obwohl gut untersucht ist, dass natürlich unterlegene Tiere dominante stürzen, ist noch kein Fall bekannt, dass sich rangniedere Tiere zusammenschließen, um das System der Rangordnung abzuschaffen. Kein Rüde hat je versucht, die Normen seiner Lebensgemeinschaft zu übertreten.
Hauser, dem es gelang, einige der damaligen Anschuldigungen der Harvard Universität experimentell wiederholbar zu widerlegen, sichtete rund 650 Untersuchungen zum Verhalten der Tiere und schildert wissenschaftlich genau, warum er zu diesen sechs Punkten gerne mehr über die kognitiven Leistungen von Tieren wissen würde. Wüsste er nämlich mehr darüber, könne er sich auch vorstellen, dass es Tierarten gibt, die ein Bewusstsein haben.
Literatur
HAUSER, M. D. 2000. Wild Minds. What Animals Really Think. Henry Holt and Company. LLC. New York. Deutschsprachige Ausgabe 2001: Wilde Intelligenz. Was Tiere wirklich denken. Deutscher Taschenbuch Verlag. München. 378 S. ISBN 3-423-34046-0.
HOERSTER, N. 2004. Haben Tiere eine Würde? Grundfragen der Tierethik. Verlag C. H. Beck oHG. München. 107 S. ISBN 3-406-51088-4.
Zum Autor:
Thomas Gehle, Jahrgang 1967, geboren in Lippe und seit fast 25 Jahren im Landesdienst von Nordrhein-Westfalen tätig, ist nicht nur Forstwissenschaftler mit Staatsexamen, sondern seit 38 Jahren auch aktiver Jäger. Er arbeitete von 1993 bis 2002 im Bereich der Populationsgenetik, wurde in diesem Fach auch promoviert und hat beispielsweise zusammen mit Sven Herzog Studien über den genetischen Zustand von Rotwild in Niedersachsen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern ebenso veröffentlicht wie über die Frage des Auftretens von Kreuzungen zwischen Rot- und Sikawild im Arnsberger Wald oder über Kreuzungen von Haus- und Wildkatze.
Seit 2003 widmet er sich ganz und gar der Jagdkunde. Unter den Niederwildarten beschäftigen ihn besonders die Ringeltaube, das Rebhuhn und der Fasan sowie die drei Sommergansarten Nil-, Grau- und Kanadagans. Aber auch mit Beiträgen über seine Studien zur Bejagung des Feldhasen, über das Leben der Kaninchen in Münster und Köln oder zum Einfluss ihrer Beutegreifer, allen voran dem Fuchs, wird er Ihnen immer wieder in Jagdmagazinen begegnet sein.